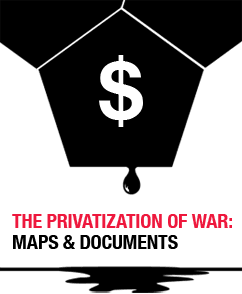Die fünfte Terrasse
Busse schaffen die Steigung nicht mehr. Jeeps mit Vierradantrieb bringen die Bewohner den Berg hoch. Das Haus der fünfköpfigen Familie Pérez liegt ganz oben in der Ansiedlung Quinta Terraza (fünfte Terrasse), auf der Spitze eines der steilen grünen Berge, die den Stadtkern der venezolanischen Hauptstadt Caracas umgeben. Quinta Terraza gehört zur Nachbarschaft Las Casitas im Stadtteil La Vega, eines der schnell wachsenden Viertel (Barrios) von Caracas. Vor 30 Jahren stand hier noch kein Haus.
Doch dann begannen Hunderttausende Familien die Berge um Caracas zu besiedeln, verarmte Bauern und Fischer aus den ländlichen Gebieten und von der Küste, aber auch arbeitslos gewordene Handwerker, Arbeiter und Besitzer kleiner Läden, die sich die Mieten im Zentrum nicht mehr leisten konnten. Heute leben auf der verniedlichend „Hügel“ genannten Gebirgskette rund um die Hauptstadt rund zwei Millionen Menschen, ein Drittel der Gesamtbevölkerung der Metropole. Bis auf wenige Ausnahmen sind es so genannte wilde Siedlungen, die keinem stadtplanerischen Konzept folgen. Oft fehlt eine urbane Infrastruktur, wie Abwassersysteme, Schulen, Gesundheitsposten, zu einigen der ärmsten Barrios führt nicht einmal ein befahrbarer Weg.
Prekäre Infrastruktur
Auch die Straße nach Las Casitas ist erst vor einigen Jahren geteert worden. An den Rändern stapelt sich der Müll, Container quellen über. Hunde und Ziegen wühlen in den Abfällen. Die städtische Abfallentsorgung wurde bereits vor vielen Jahren privatisiert. Seitdem wird der Müll in den ärmeren Vierteln nur unregelmäßig abgeholt. „Das ist eine Unverschämtheit“, sagt Alicia, die 23-jährige Tochter von Edgar Pérez, „denn wir zahlen mit der Stromrechnung automatisch auch für die Müllabfuhr.“ Frisches Wasser wird nur alle vier Tage aus Caracas hier hoch gepumpt.
Edgar Pérez, von allen nur El Gordo (der Dicke) genannt, führt uns ins oberste Stockwerk seines Hauses, das noch kein Dach hat, aber momentan mit Hilfe der Nachbarn fertig gestellt wird. Von hier oben hat man einen Panoramablick über El Libertador und die teilweise waghalsig an den Hängen klebenden Häuser, die, je höher man schaut, zu Hütten aus Wellblech, Holz und Pappe werden. „Unser Haus wird das größte hier in Quinta Terraza sein“, berichtet el Gordo stolz. „Aber wir stocken nicht für meine Familie auf, sondern unser Haus soll ein kulturelles Zentrum, ein Treffpunkt für die ganze Nachbarschaft werden.“ 30 Familien leben in Las Casitas.
Den kleinen Hof unten vor dem Haus hat die Familie Pérez kürzlich zu einem Acker umfunktioniert und der Nachbarschaft als „Übungsfeld“ für das Pilotprojekt eines Programms für urbanen Gemüseanbau zur Verfügung gestellt. Das von der linken Regierung unter Hugo Chávez entwickelte Programm unter dem mitreißenden Slogan „alle Hände zur Aussaat“ wurde Anfang 2003 in Zusammenarbeit mit der Welternährungsorganisation FAO gestartet. Einerseits soll damit die Lebensmittelversorgung der armen Bevölkerung verbessert, andererseits die landwirtschaftliche Produktion insgesamt wieder gesteigert werden. Denn momentan werden noch 60 Prozent aller Lebensmittel importiert. Die Oligarchie und der Staat begannen Mitte der siebziger Jahre die Landwirtschaft des einstigen Agrarlandes Venezuela zu vernachlässigen; die Förderung und der Export von Erdöl versprachen größere Gewinne. Als Folge wanderten die Menschen zu Hunderttausenden in die Städte ab. Heute lebt die große Mehrheit der 24 Millionen VenezolanerInnen in den urbanen Zentren des Landes. Als der Ölboom vorbei war, kletterte die Armutsrate schnell auf rund 80 Prozent.
Libertäre Selbstorganisation
Unter der brütenden Mittagssonne arbeiten acht junge Frauen auf dem winzigen Feld der Familie Pérez. Mit Spaten lockern sie die Erde auf, ziehen Furchen und streuen noch etwas unsicher knallbunte Samen aus kleinen Gläsern hinein. Ambar Centeño, Agraringenieurin des „Nationalen Instituts für Ausbildungskooperation“ (INCE), packt mit an und erteilt Ratschläge. Wenn alles klappt, werden hier in wenigen Wochen Tomaten, Zwiebeln, Salat, Paprika und Gurken wachsen. Das INCE stellt für Interessierte, die sich als landwirtschaftliche Gruppen selbst organisieren, Werkzeug, Saatgut und Beratung durch Fachkräfte. Ist genügend Land vorhanden ist, bietet das Institut auch Lehrgänge zur Bildung von Kooperativen und zum lokalen Vertrieb der Produkte an. Das wird in Las Casitas nicht der Fall sein. Denn der zur Verfügung stehende Boden reicht bestenfalls aus, um den Speiseplan der beteiligten Familien zu erweitern. Die Arbeit auf dem „Versuchsfeld“ hat vor 15 Tagen begonnen. Etwa 20 Frauen der Nachbarschaft machen hier ihre ersten Erfahrungen in der Landwirtschaft. Anschließend sollen dann insgesamt sieben kleine Äcker gemeinschaftlich bebaut werden.
Die Familie Pérez hat vor 20 Jahren „Ateneo Caribes de Itagua“ gegründet, eine Art Stadtteilinitiative, der inzwischen ein großer Teil der 30 Familien in Quinta Terraza angehört. Die Idee war, mit gemeinsamen Festen, mit Musik-, Tanz- und Theatergruppen einen kollektiven und solidarischen nachbarschaftlichen Alltag in der Siedlung zu fördern. „Wenn eine Familie ihr Haus vergrößern oder eine Hochzeit ausrichten will, helfen alle mit“, erzählt Alicia Cortes, die Frau von El Gordo. „Wir versuchen auch, Probleme wie die schlechte Wasserversorgung und Müllbeseitigung gemeinsam zu lösen.“ Auch, dass es nun das Gemüseanbau-Projekt von INCE in Quinta Terraza gibt, ist das Verdienst der Initiative.
„Unsere Basisarbeit hier in der Siedlung ist also viel älter als die Chávez-Regierung“, betont Edgar Pérez. „Aber wir unterstützen den Präsidenten so lange, wie sein politisches Programm der partizipativen Demokratie unseren Vorstellungen von sozialer und lokaler Entwicklung entspricht.“ Alicia Cortes fügt hinzu: „Das wichtigste ist allerdings der Stadtteil. Hier könnte der Präsident herkommen und sagen, es muss so und so laufen. Wenn nicht alle hier aus der Nachbarschaft einverstanden wären, würden wir uns nicht darauf einlassen. Wir sehen uns nicht als Marginalisierte, denen geholfen werden muss, sondern als Akteuren.“
Edgar Pérez und Alicia Cortes bezeichnen ihre Stadtteilgruppe als libertär. „Deshalb würden wir auch nicht in die Regierungspartei MVR (Bewegung V. Republik) eintreten“, ergänzt El Gordo, der als Chauffeur im Stadtzentrum arbeitet. Sein Ansatz sei eine politische Praxis, die am Alltag ansetze. „Politik bedeutet, das eigene Leben zu organisieren. Unsere politische Arbeit im Stadtteil dreht sich um unsere zentralen Bedürfnisse: Bildung, Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und die Regierung hat für genau diese Bereiche Programme entwickelt.“
Staatlich geförderte Selbstorganisation
Im Frühjahr dieses Jahres startete die Regierung eine regelrechte Projektoffensive; gleich mehrere Sozialprogramme wurden auf den Weg gebracht. Im Rahmen von „Barrio Adentro“, was soviel wie „im Innern des Stadtteils“ bedeutet, sind 500 kubanische Ärzte in die Barrios von Caracas geschickt worden, um ein kommunitäres Basisgesundheitssystem aufzubauen. Im Zentrum des Konzeptes stehen die Partizipation der Bevölkerung und die Prävention. Nur wenn die BewohnerInnen bereit sind, sich zu organisieren, um die Ärzte aktiv zu unterstützen, kommt ihr Stadtteil in den Genuss des Programms. So soll die betreffende Nachbarschaft selbst für ein Behandlungszimmer, ein Wartezimmer und eine Unterkunft für den Arzt sorgen. Die Regierung stellt im Gegenzug kostenlos Materialien für die Renovierung und Ausstattung zur Verfügung. Außerdem müssen die BewohnerInnen ein Gesundheitskomitee gründen, das die MedizinerInnen bei der Präventionsarbeit begleitet. Im Verwaltungsbezirk El Libertador ist ein kubanischer Arzt im Schnitt für 1.200 Menschen zuständig. 120 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr für das Programm bereitgestellt werden. Die Medien der rechten Opposition bezeichnen Barrio Adentro als kommunistische Offensive, ohne allerdings hinzuzufügen, dass einem Aufruf der Regierung an venezolanische Ärzte, sich für das Programm zu melden – man versprach ihnen sogar ein ausreichendes Gehalt – nur 80 MedizinerInnen gefolgt waren.
Die kubanischen ÄrztInnen werden zwei Jahre in Venezuela bleiben. Anschließend soll das Programm mit medizinischem Personal aus Venezuela fortgesetzt werden. Deshalb studieren bereits Hunderte von Jugendlichen aus den Barrios mit Stipendien versehen auf Kuba. Die BewohnerInnen der Armenviertel sind nicht nur glücklich über die Anwesenheit der ÄrztInnen, sondern auch sichtlich stolz drauf. In der Nachbarschaft Plan de Manzana, die im ärmsten Teil von El Libertador liegt, hat ein altes Ehepaar den vorderen Teil seines Hauses für eine Arztpraxis zur Verfügung gestellt. Die Anwohner haben alles frisch gestrichen und der kubanischen Ärztin Maria Elena ein kleines Zimmer hergerichtet. Während diese gerade ein Kind mit Bauchschmerzen untersucht, sitzt die nächste Patientin, eine junge Frau, bereits im Wartezimmer. „Diese Ärztin ist ein Segen!“, sagt Odali. „Früher hatten wir hier gar keinen Arzt und nachts war es völlig unmöglich, medizinische Hilfe zu bekommen.“
Odali kann die Kampagne der Oppositionsmedien gegen die ÄrztInnen nicht verstehen. „Das ist völlig unverantwortlich, das Fernsehen versucht uns davon zu überzeugen, nicht zu den KubanerInnen zu gehen, weil sie angeblich schlecht ausgebildet seien und das Land kommunistisch infiltrieren. Aber was ist die Alternative? Nicht zum Arzt zu gehen? Die Opposition spielt mit unserem Leben.“ Was die meisten nicht wissen: Selbst die rechte Regierung im zentralamerikanischen Guatemala hat nach dem Hurrikan „Mitch“ gerne auf kubanische ÄrztInnen zurückgegriffen, die auf das Konzept des Basisgesundheitswesens spezialisiert sind. Maria Elena kam wie alle anderen kubanischen MedizinerInnen freiwillig nach Venezuela. „Ich habe mich aus rein humanitären Gründen für die Arbeit hier gemeldet. Als Ärztin will ich Menschen helfen, die ansonsten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.“
Investition in Bildung
Während die Gesundheits- und Ernährungsprogramme engagiert, aber relativ kostengünstig umgesetzt werden, scheint sich die Regierung Bildung wirklich etwas kosten zu lassen. Nach seinem Regierungsantritt 1998 erhöhte Chávez diesen Posten im Staatshaushalt von unter 2,8 auf inzwischen über 6,4 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Verschiedene Bildungsprojekte sollen die hohe Analphabetenrate senken, aber auch die Werte der so genannten bolivarianischen Revolution, in Venezuela kurz „Prozess“ genannt, vermitteln. Dafür wurden bereits vor der Projektoffensive die Grundschulen zu „bolivarianischen Schule“. Dort werden die Kinder nach der befreiungspädagogischen Methode von Frei Betto unterrichtet, ein Konzept, das in Kuba entwickelt wurde. Vor allem aber bekommen die Kinder in den neuen Schulen zwei Mahlzeiten, was für viele die wichtigste Voraussetzung ist, um überhaupt die Schulbank drücken zu können. Außerdem eröffnete die Regierung über 2.000 geschlossene Schulen wieder, baute 675 neue Schulen, stellte 36.000 neue LehrerInnen ein und zahlte die Lohnschulden der Vorgängerregierungen ab.
Das ehrgeizige Alphabetisierungsprogramm „Mision Robinson“ hingegen ist Teil der Projektoffensive und richtet sich vor allem an Erwachsene. Ebenso wie Barrio Adentro basiert das Programm auf der Partizipation der Bevölkerung: Die Barrios müssen Räume für die Kampagne bereit stellen. Die freiwilligen Bildungspromotoren erhalten eine Einführung. Die siebenwöchigen Schnellkurse zur Alphabetisierung werden mit Videos unterstützt. Zwei Aufbaukurse sollen eine Art Hauptschulabschluss bzw. das Abitur möglich machen. Bisher haben Dank der Schnellkurse 300.000 Menschen lesen und schreiben gelernt, bis nächstes Jahr sollen es eine Million sein. Tatsächlich hat sich die Mision Robinson schon jetzt als so erfolgreich erwiesen, dass die brasilianische Regierung Anfang Oktober verkündete, eine Alphabetisierungskampagne nach dem gleichen Muster durchführen zu wollen.
Noch in Planung sind die ersten „Bolivarianischen Universitäten.“ In diesem Hochschulsystem sollen all jene studieren dürfen, die sich das Studium an den kostspieligen Privatuniversitäten nicht leisten konnten und auch an der staatlichen Universität von Caracas nicht aufgenommen wurden. Dort müssen zwar keine Studiengebühren gezahlt werden, aber die Plätze sind begrenzt und es ist ein offenes Geheimnis, dass nicht die Abiturnoten, sondern die Höhe des Bestechungsgeldes über eine Aufnahme entscheidet. Begleitet von einer sechsstündigen Fernsehkampagne des Präsidenten, haben sich an einem Sonntag Ende September 460.000 Menschen mit ihren Fächerwünschen für die bolivarianischen Universitäten eingeschrieben. Auf dieser Grundlage sollen die ersten Kurse der neuen Universitäten geplant werden. 300.000 Stipendien von etwa 100 Dollar monatlich stehen zur Verfügung.
Die Opposition kritisiert die neuen Sozialprogramme als Propaganda und wirft Chávez Populismus und Wählerfang vor. Edgar Pérez sieht das jedoch pragmatisch. „Populismus haben auch alle vorherigen Regierungen betrieben. Auch sie verteilten Staatsgelder und staatliche Hilfen. Allerdings nur als Almosen, nur in der Vorwahlzeit und nur an ihre Parteianhänger. Chávez dagegen realisiert das, wofür wir ihn gewählt haben: Er teilt den Reichtum des Landes mit den Armen. Und ich muss in keine Partei eintreten.“
Stefanie Kron und Dario Azzellini