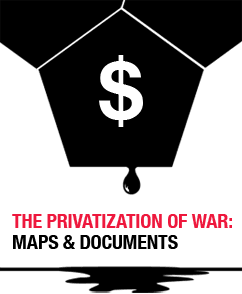Ein Gespräch mit Dario Azzellini
Durchsetzbar ist nur das, was politisch erkämpft wird
Dario Azzellini ist Diplompolitologe, Autor und Übersetzer. Er arbeitet als freier Journalist und Fotograf für Printmedien, Radio und Fernsehen und ist Mitarbeiter der Zeitschrift Arranca. Er lebt in Berlin und leitete dort 1999/2000 die deutsche Sektion der Moriana-Studie, einer Untersuchung zur Transformation der Arbeit im metropolitanen Raum. Moriana ist der Name einer der „unsichtbaren Städte“ nach Italo Calvino, einer Stadt mit zwei Gesichtern: Hinter der reich verzierten Fassade verrotten langsam die Überbleibsel einer vergangenen Epoche. Die Studie wurde initiiert vom damaligen italienischen Sozialministerium und kofinanziert von der EU, mit der Durchführung wurde das Mailänder Institut A.A.STER beauftragt. Die Studie teilte sich auf in Moriana Italien (Mailand, Genua, Turin und Neapel) und Moriana Europa (Berlin, Paris und Valencia). Obwohl die Studie wichtige Erkenntnisse über die gravierenden Veränderungsprozes- se lieferte, welche die Arbeitswelt im Übergang zum postfordistischen Produktionsmodus durchläuft, wurde das Projekt nach dem konservativen Regierungswechsel eingestellt. Dario Azzelini ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Moriana-Studie, u.a. in Kurswechsel (2/2002).
AW: Als 1998 die Textsammlung Umherschweifende Produzenten – Immaterielle Arbeit und Subversion1 erschien, sorgten die darin beschriebenen Verschiebungen des traditionell-fordistischen Arbeitsbegriffs für euphorische Momente. Die Aufhebung der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, das unmittelbare Produktiv-Werden der Kommunikation, der Affekte, der Subjektivität – all das schien quasi automatisch auf eine Emanzipierung von den Zwängen der Arbeitsgesellschaft hinauszulaufen und den Kapitalismus in seinen Grundfesten zu erschüttern. Habt ihr euch bei der Moriana-Studie auf dieses theoretische Modell bezogen?
DA: Hier in Deutschland wird die Moriana-Studie tatsächlich mit Antonio Negri in Zusammenhang gebracht, weil sich darin viele operatistische Ansätze finden. Dabei war er selbst überhaupt nicht einverstanden damit, weil die Studie ein seiner Ansicht nach falsches Organisierungsmodell propagiert und damit der spontanen Selbstorganisation der Menge entgegensteht. Das ist eben typisch Negri: Zu behaupten, dass eigentlich alles schon da ist und sich von selbst entwickelt, die Linken nur nicht in der Lage sind, das zu erkennen.
AW: War der Begriff der „immateriellen Arbeit“ wichtig für die Studie?
DA: Eigentlich nicht, denn der Fall, dass jemand ausschließlich immateriell arbeitet, ist in der Praxis eher selten. Vielmehr haben sich in den letzten Jahren komplexe Überschneidungen entwickelt zwischen traditionellen Bereichen wie z.B. handwerklichen Berufen und neuen Formen der immateriellen Arbeit. Ein Beispiel: Als ich mit zwölf Jahren für die Schülerzeitung arbeitete, haben wir uns das Papier immer von einer Druckerei schenken lassen. Damals trugen Drucker verschmierte Hornbrillen und Arbeitskittel voller Farbe, vorne am Empfang konnte man den Lärm der Druckerpressen hören. Heute empfangen Drucker ihre Kunden im Anzug, tragen Designerbrillen und haben saubere Hände, weil sie fast ausschließlich am Computer arbeiten. Solche Veränderungen finden sich in vielen Bereichen, allerdings haben die Interessenverbände diese Entwicklung noch nicht ansatzweise reflektiert. So haben wir zu Beginn der Studie auch der Handwerkskammer unsere Unterlagen zugeschickt, die uns nach mehreren Nachfragen mitteilten, sie hätten mit atypischen Beschäftigungsverhältnissen nichts zu tun und wir sollten uns an die Industrie- und Handelskammer wenden.
IV: Wie ist die Auswahl der dreißig InterviewpartnerInnen für den Berliner Teil der Moriana-Studie zustande gekommen?
DA: Im ersten Jahr haben wir Gespräche geführt mit Experten aus Politik, Verwaltung, Gewerkschaften, Industrie- bzw. Handwerkskammer und Forschung über die Veränderungen der Arbeitswelt. Im Anschluss haben wir jeden gebeten, fünf Personen aus dem persönlichen Umfeld vorzuschlagen. Dadurch kam eine sehr heterogene Gruppe von InterviewpartnerInnen zustande. In Italien war das Projekt allerdings sehr viel breiter angelegt: Da wurden in jeder der beteiligten Städte hundert Interviews in der ersten und ca. hundertfünfzig Interviews in der zweiten Runde geführt. Eine Gruppe von fünf Personen – Jugendliche, MigrantInnen oder Arbeitslose, die ein Interesse und Erfahrungen in diesem Bereich mitbrachten – haben die Verantwortlichen bei den Interviews begleitet. Die Idee war, dass diese fünf über die Forschungsarbeit an die Thematik herangeführt werden und später in den sogenannten Calas 2 mitarbeiten. In den Gesprächen selbst haben wir einen stark industriesoziologischen Ansatz verfolgt. Zusätzlich gab es noch einen Fragebogen zum sozialen Umfeld, z.B. „Wer gießt die Blumen, wenn du verreist?“ oder „Wer hilft dir beim Umzug?“ etc., um herauszufinden, ob und wie stark die betreffende Person in der Lage ist, sich ein persönliches Netzwerk aufzubauen und wie dieses Netzwerk aussieht. Darüber hinaus gab es noch einen Fragebogen zu persönlichen Daten, um möglichst viel vorher abzufragen und dann ein gutes Gesprächsinterview mit Leitfaden führen zu können.
IV: Ihr beschreibt eure Methode als „aktive Untersuchung“, was vom Vorgehen an die operatistische „Arbeiterselbstuntersuchung“ erinnert. Was genau ist damit gemeint?
DA: Das stimmt, es gibt da einen direkten Bezug. Es ging uns darum, die Subjekte selbst ihre Situation untersuchen und Antworten entwickeln zu lassen. Ein Interesse an diesem Ansatz gibt es in Italien auch in studentischen Kreisen, im Umfeld der Universitäten wurden in letzter Zeit interessante Analysen mittels der „Mituntersuchung“ entwickelt. Das hat aber nicht mehr unmittelbar mit der Moriana-Studie zu tun. Wir wollten die Leute ganz konkret zum Aufbau der Calas aktivieren, das war das Ziel.
IV: Die Idee der Calas bestand also von Anfang an und war nicht etwa das Resultat der Studie?
DA: „Calare“ heißt auf italienisch „etwas hineinsenken“. Die Idee zum Aufbau der Calas war von Anfang an da, allerdings nicht ausformuliert. Das Profil der Calas – was genau dort passieren soll, welche inhaltlichen Angebote von den Calas ausgehen usw. – sollte aus den Gesprächen heraus entwickelt werden. Leider ist es nie dazu gekommen, da das ganze Projekt nach dem Regierungswechsel in Italien eingestellt bzw. nicht fortgesetzt wurde. Die Calas hätten sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen können, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich auf eine Art Stadtteilladen mit Internetzugang hinausgelaufen. Wo Selbständige zusammenkommen, um Informationen austauschen zu können über Kunden und Auftraggeber – über Zahlungsmoral, Arbeitsklima etc. –, oder wo man sich kostenlose juristische Beratung holen kann. Die Calas hätten auch als informelle Jobbörsen fungieren können, wo man sich für komplexere Projekte ein temporäres Team zusammenstellen kann. Die Idee war, einen konkreten praktischen Nutzen mit einer politischen Mobilisierung zu verbinden.
AW: Ein Teil unseres Projektes waren zwei öffentliche Diskussionsabende, zu denen wir in Lüneburg und Graz verschiedene ExperterInnen bzw. Lobbyisten der atypischen Beschäftigung eingeladen haben. In Lüneburg saßen hauptsächlich Studierende der Kulturwissenschaft im Publikum, und es entstand bei uns der Eindruck, dass dieser Diskurs der immateriellen Arbeit eher abstrakt geführt wird und weniger auf die eigene Situation bezogen. Wie sieht das an den Universitäten in Italien aus?
DA: In Italien ist das studentische Leben inzwischen wesentlich härter als in Deutschland, der Besuch einer Universität kostet einiges und die Mehrzahl der Studierenden finanziert sich über Jobs. Den meisten ist klar, dass sie auch nach dem Studium kein reguläres Arbeitsverhältnis finden werden: Von den akademischen Neuzugängen auf den Arbeitsmarkt landen weit über die Hälfte nicht in regulären Arbeitsverhältnissen, sondern werden selbstständig tätig. Dazu kommt meiner Ansicht nach ein kultureller Faktor: In Deutschland gilt es als spießig, sich unter dreißig schon für die Rente oder Krankenversicherung zu interessieren. Es gibt hier – absurderweise, muss man sagen – nach wie vor den Glauben an Vater Staat, der im Notfall schon für dich sorgen wird. Außerdem ist die Ausrichtung auf das klassische Normalarbeitsverhältnis in Deutschland so stark wie in keinem anderen Land. Der Mythos vom Wohlfahrtsstaat Deutschland beruht auf dem Normalarbeitsverhältnis, obwohl das nie für die Mehrheit der Bevölkerung die Lebensrealität war. Das wird zwar eine Zeitlang als Spießerlebensentwurf abgetan, aber im Grunde glauben die meisten, dass sie irgendwann so ein Normalarbeitsverhältnis eingehen werden. In Italien existiert ein größeres Bewusstsein, dass prekäre Lebensverhältnisse sich nicht auf die wilden Jahre der Jugend beschränken, sondern dass die ganze Zukunft so aussieht, bis ins hohe Alter hinein. Deshalb muss man diese Verhältnissen ändern. Ein weiterer kultureller Unterschied ist die in Deutschland nach wie vor herrschende protestantische Arbeitsethik: Wenn du arbeitslos bist, ist das zunächst mal deine Schuld. Man spricht nicht darüber und organisiert sich folglich auch nicht. Im Protestantismus wird der Wert eines Menschen an seinem Wert für die Gesellschaft gemessen und als Arbeitsloser hast du natürlich schlechte Karten. In Italien, Frankreich oder Spanien ist das völlig anders: Arbeitslosigkeit wird hier in erster Linie als Versagen der Politik begriffen und damit vom individuellen zum gesellschaftlichen Problem.
AW: Das Leben als Selbständiger ist geprägt vom ständigen Wechsel zwischen Erfolg und Misserfolg, das permanente Ausgleichen des Psychohaushalts kann einen ganz schön in Atem halten. Neben den knallharten ökonomischen Fakten, die sich in verminderten Transferleistungen, niedrigeren oder ausbleibenden Honoraren, erhöhtem Arbeitsdruck oder der spürbaren Reduzierung von Förderprogrammen niederschlagen, ist der Bereich der selbständigen Arbeit – und ich spreche jetzt zunächst vom Kulturbereich, weil ich den am besten kenne – durchzogen von einem Netz subtiler psychologischer Zwänge und Abhängigkeiten. Deshalb haben wir das Workshop-Format gewählt: Einerseits konnten wir Anklänge an so etwas wie „Selbsterfahrung“ oder „Gruppentherapie“ spielerisch einsetzen, andererseits hat es tatsächlich geholfen, den psychologischen Aspekt zu fokussieren. Denn dieser Moment – vor Leuten die Hosen runterzulassen, die du nicht besonders gut kennst – kommt im Alltag der permanenten Selbstvermarktung ja nicht vor.
DA: An diesem Punkt würde ich einen meiner Meinung nach notwendigen Schritt vorschlagen: Freiberufler, Selbständige oder Kulturarbeiter müssen sich von einer Klasse „an sich“ zu einer Klasse „für sich“ entwickeln. Das wiederum würde das Bewusstsein implizieren, Teil einer kollektiven Arbeitsrealität zu sein und existenzielle Probleme nicht länger als individuelles Versagen wahrzunehmen. Ein Ergebnis der Moriana-Studie, welches eigentlich im Widerspruch steht zum Image des erfolgorientierten Hyper-Individualisten, ist nämlich, dass im Bereich der selbständigen Arbeit sowohl der Wunsch als auch – bedingt durch die Arbeit in Netzwerken – die praktischen Voraussetzungen für eine kollektive Praxis vorhanden sind. Andererseits sind wir auf eine große Skepsis gestoßen, was die tatsächliche Umsetzung betrifft: Es wurde immer wieder geäußert, dass die Lebensrealitäten und damit zusammenhängend die Bedürfnis der Berufsgruppen doch zu verschieden sind, um gemeinsam agieren zu können.
AW: Das deckt sich mit unseren Workshop-Ergebnissen: Der Wunsch nach einer gemeinsamen Interessenvertretung und mehr Solidarität untereinander wurde sehr deutlich artikuliert, gleichzeitig sind alle viel zu sehr absorbiert von der Organisierung ihres komplexen Alltags, um Zeit und Energie zum Aufbau solcher Strukturen aufzubringen.
DA: Das liegt auch daran, dass zur Zeit wenig Klarheit darüber besteht, wie diese Strukturen aussehen könnten und was sie für den Einzelnen konkret für Vorteile bringen. Denn wenn du überzeugt bist vom Nutzen, bringst du auch eher die Zeit für eine politische Arbeit auf. Aber ich denke, soweit sind wir noch gar nicht. Zur Zeit geht es eher darum, ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen.
IV: Was schlägst du vor?
DA: Ich kann wieder nur auf Italien verweisen: Organisiert von den Centri Sociali fand jeweils zum 1. Mai in den letzten Jahren in Mailand eine Parade statt, die sich thematisch auf prekäre Arbeitsverhältnisse bezog. Mit bunt aufgemachten Wägen und einer massiven Beteiligung von fast 20.000 Leuten. Für mich ist das ein erster Schritt, um sich als Gruppe öffentlich zu artikulieren. Ein sehr wichtiger Ansatz ist die „Generalisierung des Streiks“, wie es die Disobbidienti nennen. Das bedeutet, dass Aktionsformen entwickelt werden von all denjenigen, die aufgrund der Art ihrer Beschäftigung oder aufgrund von Arbeitslosigkeit keine Möglichkeit haben, am Arbeitsplatz zu streiken. Zum Beispiel, indem Warenströme unterbrochen oder Zufahrtswege zu bestreikten Firmen blockiert werden. In Italien und Spanien wurde auch mit der Möglichkeit experimentiert, die Streikdauer auszuweiten: Von acht Stunden, also der Länge eines normalen Arbeitstages, auf vierundzwanzig Stunden und länger, um so auch andere Sektoren in den Kampf zu integrieren und ein postfordistischen Produktionssystem tatsächlich zu bestreiken. Außerdem ist es wichtig, die Streiks aus den Betrieben herauszutragen. Die Erfahrung der letzten hundert Jahre ist doch, dass nur das durchsetzbar ist, was politisch erkämpft wurde. Deshalb halte ich es für extrem wichtig, diese Diskussion jetzt zu führen, denn dass ein kompletter gesellschaftlicher Umbau kommen wird, steht außer Frage. Wenn wir uns aber nicht im Vorfeld auf unsere Forderungen verständigen, wird das Ergebnis für uns verheerend sein. Deshalb fand ich z.B. auch die Diskussion um das Existenzgeld wichtig. Nicht weil ich glaube, dass damit alle Probleme gelöst werden können, sondern weil etwas in diese Richtung sowieso kommen wird. Aber wenn es keine entsprechende Organisierung gibt, wird es eben die FDP-Lösung sein mit €250 im Monat und Negativbesteuerung. Es muss und wird gravierende Veränderungen geben. Die Frage, ob diese für uns positiv oder negativ ausfallen, hängt vom Stand der Kämpfe ab.
AW: Im Gegensatz zu Frankreich oder Italien, wo das Thema „Prekarität“ auch von kulturellen Akteuren aufgegriffen wird, geht die Diskussion in Deutschland vor allem von den Arbeitsloseninitiativen aus. Es ist für hiesige Kulturproduzent- Innen nach wie vor naheliegender, sich für die Belange von MigrantInnen, Illegalisierten oder Obdachlosen zu engagieren, als bei sich selbst anzusetzen. Diesen Punkt – diesen blinden Fleck – finde ich sehr wichtig, wenn man über mögliche Aktions- und Organisationsformen nachdenkt. Das vorherrschende Selbstverständnis, welches auch in den Workshops durchklang, ist nach wie vor das der doppelten Privilegierung: Zunächst das Privileg, Teil der „Ersten Welt“ zu sein und darüber hinaus aufgrund von Status und Ausbildung das Privileg der Wahl zwischen mehreren möglichen Lebensentwürfen zu genießen.
DA: Ein privilegierter sozialer Status ist noch lange kein Grund, ständig ein schlechtes Gewissen vor sich herzuschieben. Letztendlich haben wir es mit einem zusammenhängenden System zu tun: Wenn es den Leuten hier schlechter geht, geht es denen, denen es sowieso schon schlecht geht, noch schlechter. Es mag vielleicht auf den ersten Blick wichtiger sein, die Kämpfe an den Rändern zu führen – dort, wo es tatsächlich um das nackte Überleben geht –, aber es ist natürlich klar, dass die zentralen Kämpfe in der Mitte geführt werden müssen, wenn sich politisch grundlegend etwas verändern soll.
Anmerkungen:
1 Umherschweifende Produzenten – Immaterielle Arbeit und Subversion, Hrsg. Thomas Atzert, Berlin, 1998
2 Centri di Aggregazione del Lavoro Autonomo (Zentren der Organisation der Autonomen Arbeit). Die CALAs waren als öffentliche Plattformen konzipiert, auf welcher sich die neuen Akteure der autonomen Arbeit selbst vertreten und mit anderen gesellschaftlichen Kräften wie z.B. Gewerkschaften oder Gemeindeverwaltungen in Dialog treten können