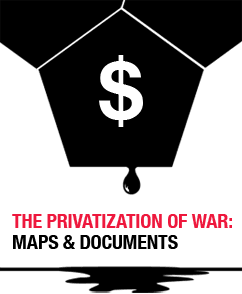Von der »heißen Ecke« an verbarrikadierten Luxusbauten vorbei ins Armenviertel. Ein Streifzug durch Caracas
Das Versprechen der Wachhabenden
Auf dem Platz gegenüber des oppositionell regierten Rathauses von Caracas wurde von den bolivarianischen Basisorganisationen ein »Rincón caliente« ausgerufen, eine »heiße Ecke«. Jeden Tag, von morgens bis abends, stehen hier bis zu 200 Menschen in kleinen Gruppen und diskutieren über Politik und die Situation im Land oder die wichtigsten internationalen Themen. Ana verkauft hier Kaffee aus zwei großen Thermoskannen: eine Art Espresso in winzigen Plastikbechern, klein, schwarz und süß, so wie ihn die Venezolaner mögen. Ana ist eine robuste Frau Mitte Fünfzig mit kurzgeschnittenen grauen Haaren. Sie trägt ein Stirnband, das sie als Chávez-Anhängerin identifiziert und zahlreiche Buttons zugunsten der bolivarianischen Revolution und gegen den Krieg. Wir kommen schnell ins Gespräch, und sie erzählt, sie sei als Kind mit ihren Eltern nach Venezuela eingewandert. Trotz Armut bleibt sie, und selbst wenn es möglich wäre, würde sie um nichts in der Welt nach Spanien ziehen. »Hier haben wir wenigstens einen anständigen Präsidenten!« erklärt sie mir mit einem Strahlen im Gesicht, »Aznar hingegen ist ein Verbrecher, Spanien hat im April 2002 die Putschisten unterstützt!«
Ich treffe Felix Antillano, der im Aluminiumwerk Alcasa in Ciudad Guayana im Bundesstaat Bolivar im Osten des Landes arbeitet. Dort ist er in der Gewerkschaft Sintralcasa aktiv, zu der fast 90 Prozent der im Aluminiumwerk Beschäftigten gehören. Stolz erzählt er, daß in Ciudad Guayana der von der Oppositionsgewerkschaft CTV seinerzeit um die Jahreswende ausgerufene Streik gegen den 2000 zum zweiten Mal gewählten venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez in keiner einzigen Fabrik befolgt wurde. »Das ist auch klar, denn die aktuelle Führung der CTV kam nur durch einen Wahlbetrug an die Spitze des Gewerkschaftsdachverbandes. Die Stimmen aus Bolivar, dem größten aller Bundesstaaten, wurden gar nicht erst gezählt. Und vor dem Obersten Wahlrat ist seit über einem Jahr eine Klage deswegen anhängig, doch da dieser lange Zeit von der Opposition kontrolliert wurde, geschah nichts.« Sichtlich erregt erzählt Felix davon.
Der verärgerte Mann ist für ein Gewerkschaftstreffen nach Caracas gekommen. Seine Gewerkschaft trat inzwischen dem im April neu gegründeten Dachverband UNT (Nationale Arbeiterunion) bei, wie über 1500 weitere Einzelgewerkschaften allein in der ersten Woche nach Gründung. Die meisten davon – darunter Felix’ Gewerkschaft, die der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Arbeiter der U-Bahn von Caracas und viele mehr – gehörten zuvor zu CTV. Auch mit der Zahl seiner Mitglieder hat der UNT die unter Arbeitern verhaßte CTV überholt. »Die CTV ist völlig korrupt, hat den Putsch unterstützt, mit den Unternehmern gemeinsame Sache gemacht und vertritt schon lange nicht mehr die Interessen der Arbeiter«, so Felix.
Nein, die UNT sei keineswegs »chavistisch«, wie Felix betont. Er selbst allerdings ist ein glühender Unterstützer des bolivarianischen Prozesses der sozialen Umgestaltung. »Es gab zuvor mit der FBT (Bolivarianische Arbeiterkraft) einen Versuch, eine regierungsnahe Gewerkschaft zu gründen. Aber gerade wegen der Regierungsnähe hat es nicht funktioniert. Eine Gewerkschaft muß, auch wenn sie den von der Regierung eingeschlagenen Weg unterstützt, unabhängig sein. Nur so kann sie die Interessen der Arbeiter vertreten. Und so ist das im Fall der UNT«, berichtet Felix.
Der Putsch und der Unternehmerstreik haben viele Menschen aufgeweckt und den Organisierungsprozeß beschleunigt. Viele Zusammenschlüsse sind neu entstanden. Manche bereits existierende wuchsen rasend schnell. Da das venezolanische Modell stark darauf basiert, die Selbstorganisierung zur Basis der Veränderung zu machen, hat dies den Transformationsprozeß verstärkt. Die Unterstützung für Chávez und die »bolivarianische Revolution« scheint trotz stärkerer ökonomischer Probleme größer als noch vor einem Jahr – auch deshalb, weil die Opposition noch immer wegen deren Sabotageakten in der Erdölproduktion und der absichtlichen Zerstörung der Wirtschaft diskreditiert ist. Selbst Angehörige der Oberschicht nehmen nun, nach Bekanntwerden der Verwicklung zahlreicher oppositioneller Militärs in Morde und Bombenanschläge, Abstand von der Opposition. Viele hatten der Medienpropaganda der vom ultrarechten Medienmogul Gustavo Cisneros kontrollierten großen privaten TV-Sender über ein schnelles Ende der Ära Chávez geglaubt. Eingeschlossen in ihren luxuriösen Mikrokosmos hatten sie die Unterstützung für den Präsidenten völlig unterschätzt. Mittlerweile organisieren sich auch bedeutende Teile der Mittelschichten in Vereinigungen, die den bolivarianischen Prozeß unterstützen – »Clase media en positivo« nennen sich ihre Zirkel.
Das Fernsehen trommelt dennoch unaufhörlich weiter gegen den Regierungskurs. In Talkshows bezweifeln Psychologen die Zurechnungsfähigkeit des Präsidenten, während gleichzeitig Stars bekannter Telenovelas sich gegen »die Diktatur in Venezuela« wenden. Argumente werden nicht geboten. Noch Wochen nach dem Irak-Krieg strahlten die größten privaten Sender alle 20 Minuten ein und denselben Sport aus: Saddam Hussein und ihm zujubelnde Massen. Die US-Truppen marschieren in den Irak ein. Schnitt. Chávez erscheint, dazu Bilder jubelnder Regierungsanhänger aus unteren Schichten. Schnitt und der Schriftzug: »Jetzt holen wir dich.«
In den Augen der Oberschicht ist Chávez an allem schuld. In erster Linie natürlich an der schlechten wirtschaftlichen Situation, wobei nicht zur Kenntnis genommen wird, daß diese vornehmlich durch oppositionelle Großunternehmer bewirkt wurde, die allein von 1998 bis 2002 über 33 Milliarden Dollar ins Ausland abzogen. Die Einnahmeverluste durch Sabotage der Erdölförderung seitens der Opposition schlugen mit sieben Milliarden Dollar zu Buche. Doch selbst bei Kleinigkeiten wird dem Präsidenten die Schuld zugeschoben. »So schlimm ist das mit Chávez«, resümiert eine ältere Venezolanerin Ende Fünfzig, an Schmuck und Auftreten unschwer erkennbar als Angehörige der Oberschicht, als am Flughafen die Klimaanlage nicht funktioniert. Die Hysterie der Oberschichten kennt keine Grenzen. Ihre Wohnviertel und Häuser vermitteln den Eindruck von Kriegszustand. Stacheldraht, Gitter, Kameras und zusätzliche Wachposten. Straßen sind blockiert mit betongefüllten Fässern. Es ist die Angst vor den Armen.
Die größte Unterstützung hat Chávez unter den Armen, und die machen immerhin 80 Prozent der Bevölkerung Venezuelas aus. Ihre Stadtteile ziehen sich an den Hängen um Caracas hoch.
Eines dieser Armenviertel ist »23 de enero«, »der 23. Januar«. Früher hieß der Stadtteil »2. Dezember«, doch seitdem die Bewohner des Viertels und Militärs am 23.1.1958 die Regierung des Diktators Marco Perez Jímenez stürzten, wechselte der Name. Im Kern des 1950 entstandenen Viertels stehen einige Neubaukästen rund um einen riesigen Hof. Ein Projekt des Stararchitekten Le Corbusier. Seine Vorstellung eines sozialeren urbanen Wohnens läßt sich allerdings nicht unbedingt als verwirklicht bezeichnen, wovon die von diesem Stadtteil ausgehenden Proteste gegen mangelnde Wasser- und Stromversorgung und andere Mißstände erzählen. Von 1958 bis zu Chávez’ Machtübernahme wurden 37 Aktivisten von Polizei, Militär, Geheimpolizei oder Nationalgarde getötet. Und während des 47 Stunden dauernden Putsches gegen Chávez war der Stadtteil Ziel von über 600 Hausdurchsuchungen durch die den Putschisten treuen Teile der Geheimpolizei.
Im Laufe der Jahrzehnte wuchs das Viertel nicht nur durch den Bau von sechs- bis achtstöckigen Wohnblocks, auch kleine Häuschen wuchern in alle Himmelsrichtungen. Vor allem im höher gelegenen Teil reihen sich winzige Hütten aneinander, die aus allen nur denkbaren Materialien gebaut wurden. Das Leben spielt sich jedoch auf dem großen, von Wohnblöcken umbauten Platz ab. Zwischen Wandgemälden von Che Guevara, den Zapatisten und Simon Bolivar wird Ball gespielt, Bier getrunken und sich unterhalten. Imbißbuden und provisorische Autowerkstätten haben hier aufgemacht, und in den garagenartigen Ladenlokalen im Erdgeschoß der Häuser befinden sich kleine Läden sowie das Lokal der »Coordinadora Simon Bolivar«, der ältesten Basisorganisation des Stadtteils. An der Wand hängt eine große Fahne, auf der der lateinamerikanische Befreier als Teil der Bauernbevölkerung zu sehen ist. »Wir sagen nicht dem Volk, was es machen soll, wir lernen vom Volk«, ist dort zu lesen.
Die Coordinadora unterstützt den bolivarianischen Prozeß und organisiert soziale, politische, sportliche und kulturelle Aktivitäten. Das Verhältnis zu den Regierungsparteien ist gut, doch die Organisation betont ihre Unabhängigkeit: »Uns gab es vor Chávez, und es wird uns nach Chávez geben«, unterstreicht Omar, ein kräftiger Mitvierziger, der wie ein Boxer aussieht. Er berichtet davon, wie der Stadtteil während des Putsches gesuchten Aktivisten und Regierungsmitgliedern als Unterschlupf diente und wie sich aus ihm heraus schließlich ein unüberschaubarer Menschenstrom bildete, der dann zum Präsidentenpalast floß. Im »23 de enero« wurde auch die erste von 57 landesweit geplanten »Boticas Populares« eröffnet, in denen die Armen Venezuelas von Ärzten des kostenlosen öffentlichen Gesundheitssystems verschriebene Arzneimittel mit Ermäßigungen von 85 bis 90 Prozent kaufen können.
Im höher gelegenen Teil des Viertels liegt eine Armeekaserne, die wie eine kleine Festung aussieht. Von hier aus kann man die gesamte Innenstadt überblicken, den Präsidentenpalast und seine Höfe mit eingeschlossen. Wegen dieser Lage gingen die meisten Armeerebellionen und Putschversuche der vergangenen hundert Jahre von der Kaserne aus, auch der Putschversuch von Hugo Chávez 1992 gegen den heute wegen Korruption angeklagten Carlos Andres Perez. Vor der Kaserne haben Bewohner des Viertels einen schmalen Streifen begrünt, den sie im Überschwang »Parque Che Guevara« tauften. Gegenüber ist auf Wandtafeln eine Ausstellung zum Putsch zu sehen.
Ich frage am Kasernentor, ob ich fotografieren darf. Der ranghöchste Kommandant wird geholt und erklärt mir, daß dafür eine Genehmigung des Verteidigungsministeriums notwendig sei. Die könne innerhalb weniger Stunden ausgestellt werden. Er fragt mich, woher ich komme und was ich in Venezuela tue. Als ich ihm von meinem großen Interesse am bolivarianischen Prozeß berichte, strahlt er, schüttelt mir die Hand und versucht, telefonisch eine Genehmigung einzuholen. Doch es ist schon Abend, und die Verantwortlichen sind nicht mehr zu erreichen. Die wachhabenden Soldaten haben sich ebenfalls genähert, reichen mir die Hand und versprechen zum Abschied: »Wir in dieser Kaserne werden niemals zulassen, daß der Prozeß rückgängig gemacht wird. Wir stehen auf seiten des Präsidenten und des Volkes.«