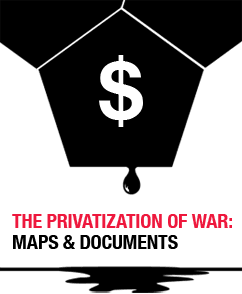Indigenas drohen in Brasilien mit Selbstmord, in Ekuador mit Besetzungen
Sie wollen keine Opferlämmer mehr sein
Etwa 250 Angehörige der Guaranis, einer indigenen Gruppe im brasilianischen Bundesstaat Matto Grosso du Sul, sollen jetzt von ihrem angestammten Siedlungsgebiet vertrieben werden. Sie sollen Platz schaffen für die Rinderherden eines Plantagenbesitzers. Nach einem Beschluß des Bundesgerichtes müssen sie bis zum 29. Januar das Land verlassen, ansonsten folgt die Räumung. Falls die brasilianischen Behörden das Urteil vollstrecken, haben die verzweifelten Guaranis mit kollektivem Selbstmord gedroht.
Dabei gehört das Land sogar juristisch gesehen den Guarani. Nachdem sie bereits 1990 aus dem etwa 2.000 Hektar umfassenden Gebiet an der Grenze zu Paraguay vertrieben worden waren, war es ihnen 1992 vom brasilianischen Justizminister zugesprochen worden. Dennoch rücken ihnen die Viehzüchter buchstäblich zu Leibe aber schon jetzt reicht das Land, auf dem sie leben, nicht mehr zur Existenzsicherung aller Stammesangehörigen aus. Seit 1986 gab es 124 Selbstmorde.
Eigentlich hatte die indigene Bevölkerung des amerikanischen Kontinents 1992 zum Jahr des Widerstandes gegen "500 Jahre Kolonialisierung und Unterdrückung" erklärt und die UNO 1993 zum "Jahr der Ureinwohner" ausgerufen. Die Hoffnungen, die viele Indigenas damit verbunden hatten, sind jedoch enttäuscht worden. Während sich selbst in solchen Hoch-Zeiten kaum jemand um ihre Probleme und Forderungen kümmert, gehören ihnen, sobald sie zu den Waffen greifen, die Titelseiten der Tageszeitungen.
Erst wenn die amerikanischen Indigenas nicht mehr die für sie vorgesehene Opferrolle spielen, werden sie bemerkt. Den Zapatisten in Mexiko übrigens keine "Indianer-Guerilla", sondern eine Guerilla mit starker Berücksichtigung indigener Forderungen und großer Beteiligung von Indigenas wurden erst Verhandlungen angeboten, nachdem sie gezeigt hatten, daß sie auch eine militärische Bedrohung darstellen. Kein Wunder, daß die EZLN nicht bereit ist, über ihre Waffen zu verhandeln. Doch selbst, wenn es zu Verhandlungen kommen sollte, wird das Ergebnis kaum mehr als soziale Kosmetik sein.
Kaum drei Wochen nach Chiapas drohen nun ekuadorianische Indigenas, Erdölfelder zu besetzen und die Förderung lahmzulegen, sollte die Regierung geplante Auktionen von Förderungsrechten nicht mindestens 15 Jahre aussetzen. Vergangenes Jahr hatten die Indigenas wegen Umweltverschmutzung den US-amerikanischen Ölmulti "Texaco" verklagt. 1992 hatten sich Hunderttausende an Protestmärschen beteiligt, Auseinandersetzungen mit
Großgrundbesitzern kosteten mehrere Indigenas das Leben.
Auch in Ekuador soll sich ähnlich wie in Chiapas seit Jahren eine Guerilla-Bewegung vorbereiten. In anderen Ländern Amerikas sind ähnliche Entwicklungen zu erwarten. Steht der Kontinent vor neuen Stürmen?