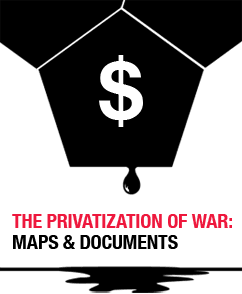10 Jahre Bolivarianischer Prozess an der Regierung
Venezuela: Die konstituierende Macht in Bewegung
In den letzten Jahrzehnten hat vor allem die Frage nach der Übernahme der (Staats-)Macht für Kontroversen innerhalb der Linken gesorgt. Ob der Staat übernommen wird, bis zu einem bestimmten Punkt mit staatlichen Institutionen zusammengearbeitet werden solle oder doch lieber jede Kooperation vermieden werden müsse, war ein zentraler Streitpunkt. Die Wahl verschiedener linker Regierungen in Lateinamerika, vor allem die Fälle Venezuelas und Boliviens, spielen eine zentrale Rolle. Mit der Wahl von Hugo Chávez zum Präsidenten Venezuelas und seiner Amtsübernahme Anfang 1999 begann ein Prozess wirksamer und auf eine sehr breite linke Bewegung gründender sozialer Transformationen, der die Linke zwingt, bestimmte tradierte Konzepte neu zu denken.
In Venezuela wurde ein ‹Aufbau von zwei Seiten› begonnen, der sowohl Strategien und Herangehensweisen ‹von unten› wie ‹von oben› umfasst. Also sowohl solche, die eher in der konstituierenden Macht, den Bewegungen, der organisierten Bevölkerung die zentrale Kraft der Veränderung sehen, als auch solche, die diese in der konstituierten Macht, im Staat und den Institutionen sehen. Am Transformationsprozess sind traditionelle politische Organisationen und Parteien mit staatszentrierter Orientierung genauso beteiligt wie auch antisystemische Strömungen und Gruppierungen. Dabei existiert eine intensive Interaktion von Bewegungen und Basisorganisationen mit Kräften und Institutionen des Staates.
Keine der verschiedenen linken Strömungen oder Ideologien hatte zuvor die Möglichkeit eines revolutionären Transformationsprozesses von derartiger sozialer Tiefe und Reichweite prognostiziert. Die Bolivarianische Revolution hat eine sehr eigene Entwicklung genommen. Sie begann nicht als sozialistische Revolution, sondern in Form einer anti-neoliberalen Bewegung, die sich im Laufe der Zeit radikalisierte. Sie wurde nicht von einer Gruppe oder Partei angeführt – lange Zeit gab es gar keine große Partei oder Arbeiterorganisation, ja nicht einmal eine Zeitung. Der Prozess besitzt keine erklärte Ideologie, der zu folgen ist, sondern bezieht sich auf eine Reihe von Werten, die als Orientierung gelten (wie etwa Solidarität, Kollektivität, Recht auf Partizipation u.v.m.).
Im Laufe der Jahre führte der Suchprozess zu einer sozialistischen Orientierung. Während die Debatten um Partizipation sich zu Beginn in einem demokratischen Kontext verorten ließen, der jenseits von Kapitalismus und Sozialismus einen ‹Dritten Weg› postulierte, hat sich der Diskurs mit der Zeit immer weiter nach links verschoben. 2005 bezeichnete Chávez den Sozialismus als einzige Alternative zur Überwindung des Kapitalismus. Und ab 2007 wurde Partizipation als offizielle Regierungspolitik in einem Kontext gesehen mit Poder Popular (‹Volksmacht›), revolutionärer Demokratie und Sozialismus. Der Bolivarianische Prozess sucht einen neuen Weg jenseits der bekannten Optionen sozialer Transformation. Es wird versucht, die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft ausgehend von der Interaktion zwischen oben und unten neu zu denken, um schließlich neue Perspektiven zur Überwindung der kapitalistischen Strukturen zu entwerfen.
Entsprechend der normativen Grundorientierung des Prozesses wird der Staat als Teil des Alten, und damit als etwas, das es zu überwinden gilt, angesehen. Er ist somit auch nicht der Akteur des Wandels: Die zentrale Rolle kommt den Bewegungen, der organisierten Bevölkerung zu. Der Staat soll diesen Prozess begleiten und die Prozesse ‹von unten› unterstützen, damit die Bewegungen als konstituierende Macht Mechanismen und Wege hervorbringen, um die Gesellschaft zu verändern. Dem Staat kommt vor allem die Funktion zu, die materiellen Inhalte für die Verwirklichung des Gemeinwohls zu garantieren.
«Wenn wir nicht erfinden, dann irren wir.»
In Anbetracht fehlender ‹objektiver Wahrheiten› bezüglich des Aufbaus des Sozialismus ist es nicht überraschend, dass sich die Aussage von Simón Rodríguez, Frühsozialist und Lehrer des antikolonialen Helden Simón Bolívars, «wenn wir nicht erfinden, dann irren wir», zu einer zentralen Losung im Transformationsprozess entwickelt hat. Es existiert eine große Anzahl von Initiativen, Institutionen und Ansätzen nebeneinander, die oftmals ebenso schnell wieder aufgegeben oder verändert werden wie sie propagiert wurden, wenn sich herausstellt, dass andere Initiativen oder neue Ideen besser funktionieren.
Der Bolivarianische Prozess war von Beginn an durch unterschiedliche Strategien geprägt: durch eine ‹von oben›, das heißt eher von Staatsseite bzw. von Institutionen geprägte, und eine ‹von unten›, verbunden mit den nach Autonomie und Selbstregierung strebenden Bewegungen, die Repräsentation zurückweisen und sich selbst zu Akteuren machen. Jene, die diesen Prozess von unten unterstützen, kritisieren existierende bürokratische Strukturen und die Parteien, denen sie anlasten, Entscheidungen zu monopolisieren, parteiinterne Korruption zu ignorieren und durch den Aufbau bürokratischer Hürden insgesamt demobilisierend zu wirken.
Ab Januar 2007 spricht Chávez von der Notwendigkeit, den bürgerlichen Staat durch die Errichtung eines kommunalen Staates zu überwinden. Er griff damit eine Debatte auf, die aus den antisystemischen Strömungen kam und verallgemeinerte sie. Die Grundidee ist, dass überall und zu grundsätzlich allen Belangen Rätestrukturen gegründet werden können, die künftig Schritt für Schritt die Institutionen des bürgerlichen Staates ersetzen sollen. Der Staat wird dabei nicht als ein neutrales Instrument (leninistischer Ansatz) oder als autonome Instanz (wie in der bürgerlichen und sozialdemokratischen Tradition) angesehen, sondern als integraler Bestandteil des Kapitalismus, und soll als solcher überwunden werden.
Die größte Herausforderung dabei ist, diesen Prozess offen zu halten und Praktiken zu entwickeln, die den ‹Prozess von unten› unterstützen, begleiten und stärken, ohne ihn zu kooptieren oder einzuschränken.
Das alles geschieht in einem Umfeld, das – trotz konstanter Veränderungen der Definition der Form und der Rolle des Staates in den vergangenen zehn Jahren – nach wie vor kapitalistisch ist und in einem politischen System, das nach wie vor repräsentativ und liberal organisiert ist.
Die konstituierende Macht – Motor der Geschichte
Eine der normativen Orientierungen des Bolivarianischen Prozesses liegt in der Priorität der konstituierenden Macht, nicht verstanden als temporär oder als Moment der kurzfristigen Übertragung von Macht oder Souveränität, sondern als permanente schöpferische Kraft des Pueblo (Volk/Bevölkerung), die sich gegen die konstituierte Macht durchsetzt. Derart wird auch die Idee der Mediation, die der Logik der Trennung zwischen Zivilgesellschaft und Sphäre des Politischen eigen ist und wie sie beispielsweise die NGOs repräsentieren, zurückgewiesen. Es geht viel mehr darum, das Potenzial und die direkte Fähigkeit der Basis, das, was das eigene Leben betrifft, selbst zu analysieren, zu entscheiden, auszuführen und zu evaluieren.
Das Konzept hat in Venezuela seinen Ursprung in den Bewegungen der späten 1980er Jahre, als die Vorstellung sozialer Transformation als kontinuierlicher konstituierender Prozess formuliert wurde. Während der 1990er Jahre gewann die Idee große Relevanz in den sozialen Bewegungen und es wurde die Übereinstimmung mit dem von Antonio Negri in seinem Buch Die konstituierende Macht (nicht auf Deutsch erschienen) formulierten Konzept festgestellt. Auch Chávez, der das Buch im Gefängnis las (1992-1994), unterstreicht den großen Einfluss des Konzeptes auf den Bolivarianischen Prozess.
Die konstituierende Macht ist die legitime, kollektive, schöpferische Kraft, die den Menschen eigen ist, die Fähigkeit, etwas Neues zu entwickeln, ohne es aus dem bereits Bestehenden abzuleiten oder diesem unterwerfen zu müssen. Die konstituierende Macht ist allmächtig und expansiv und somit die Rechtfertigung und die Grundlage einer jeden Revolution, Demokratie und Republik. Sie ist also der bedeutendste Motor der Geschichte, die wichtigste und mächtigste Kraft sozialer Innovation. Doch historisch wurde die konstituierende Macht stets von der konstituierten Macht zum Schweigen gebracht und ihrer Aktionsmöglichkeiten beraubt, sobald sie ihre Funktion erfüllt hatte, die Existenz der konstituierten Macht zu legitimieren.
Die Frage ist also, wie die konstituierende Macht die ständige Möglichkeit haben kann, auf den Plan zu treten und die Wirklichkeit zu verändern, Impulse zu geben und etwas Neues zu schaffen. So wird Revolution nicht als ein Akt der Machtübernahme verstanden, sondern als vielschichtiger Prozess der Konstruktion des Neuen, ein Akt der Schöpfung und Erfindung.
Der Bolivarianische Prozess entsprach bisher nur bedingt den Grundthesen des Konzeptes der konstituierenden Macht. So war die Verfassunggebende Versammlung von 1999 zwar souverän und originär, jedoch bestand sie aus Repräsentanten und nicht Delegierten. Wichtige Impulse des Konzeptes der konstituierenden Macht wurden aber in die neue Verfassung aufgenommen, wie etwa verschiedene Mechanismen der «partizipativen und protagonistischen Demokratie », die explizit keine Trennung der sozialen, politischen und ökonomischen Sphäre vornehmen. In den folgenden Jahren rückte die Idee eines popularen konstituierenden Prozesses allerdings in den Hintergrund. Das war der Zentralität von Chávez geschuldet und vor allem der konfliktgeladenen innenpolitischen Situation, die viele Bewegungen dazu zwang, den Prozess gegen die ständigen Angriffe der Opposition zu verteidigen, anstatt sich seinem Aufbau zu widmen.
Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel den Urbanen Landkomitees (CTU, Selbstorganisierung zur Legalisierung urbaner Wohngrundstücke), gab es kaum weit verbreitete Erfahrungen protagonistischer Partizipation und selbst von den in der neuen Verfassung enthaltenen Partizipationsmöglichkeiten wurde kaum Gebrauch gemacht. Zudem betrachteten viele in der bolivarianischen Führungsebene die konstituierende Macht als Wurmfortsatz der repräsentativen Strukturen und nicht als zentrale Quelle aller Entscheidungsfindung. Dennoch war die Selbstorganisierung der Basis auch in jenen Jahren mindestens zu zwei Gelegenheiten der entscheidende Faktor für die Fortsetzung des Prozesses: Im Zuge der Umkehr des Putsches 2002 und beim ‹Ölstreik› 2002/03. Die führende Rolle hatte die konstituierende Macht inne und nicht die konstituierte Macht oder die Parteien. Das Gleiche geschah auch mit den Fabrikbesetzungen durch die Arbeiter. Die Regierung brauchte zwei Jahre, um eine klare Position dazu zu formulieren. Seit 2003/2004 leitet die Regierung eine Politik in die Wege, welche die Strategie ‹von unten› stärkt und darauf zielt, die Partizipation in den Comunidades und auf der Arbeit zu fördern.
Die Realität ist jedoch sehr komplex und es besteht ein widersprüchliches Verhältnis von Konflikt und Kooperation. Mit der institutionellen Öffnung und der Ausweitung der Sozialprogramme entstanden neue Bewegungen, gleichzeitig aber begannen viele Kader und Führungsfiguren aus den Bewegungen in den Institutionen zu arbeiten, wodurch die Bewegungen geschwächt wurden. Die Zunahme der protagonistischen Partizipation führte darüber hinaus zu einer Zunahme der Konflikte zwischen Staat und Basis (speziell im Produktionssektor) und im Staat selbst, der sich ebenfalls in eine Ebene des Klassenkampfes verwandelt. Dies ist nicht überraschend, bedenkt man, dass die Vertiefung sozialer Transformation auch die Stellen vermehrt, an denen sich die unterschiedlichen Logiken von ‹unten› und ‹oben› begegnen und in Konflikt geraten.
Die Rolle von Chávez ist ebenfalls ambivalent. Er fungiert als eine Art Lautsprecher und erfüllt eine wichtige Rolle damit, die öffentliche Aufmerksamkeit auf ansonsten eher unbekannte Initiativen von ‹unten› zu lenken und so ihre Ausbreitung zu fördern. In einigen Fällen führt dies jedoch gleichzeitig dazu, dass ein organisches Wachstum der Initiativen erschwert wird, weil politische Führungsfiguren, Bürgermeister und einige Institutionen, mit der ihnen immanenten Logik, stärker darum bemüht sind, künstlich Initiativen schaffen, die von Chávez gutgeheißen werden, als ein qualitatives Wachstum von unten zu unterstützen.
Poder Popular als Praxis des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft
Die Idee der Poder Popular ist eng mit dem Konzept der konstituierenden Macht verknüpft. Beide wurden in den frühen 1990er Jahren entwickelt und hatten, obwohl sehr einflussreich in den Bewegungen, in den Anfangsjahren des Prozesses nicht besonders viel Einfluss auf Regierungsebene. Seit 2005 werden der Aufbau der ‹partizipativen und protagonistischen Demokratie› und später auch des Sozialismus im offiziellen Diskurs mit Poder Popular verknüpft.
Historisch wurde Poder Popular stets als die Notwendigkeit einer parallelen Macht in revolutionären Prozessen verstanden, um eine Situation der doppelten Macht zu schaffen. Nach der Konsolidierung der neuen Strukturen der ‹wirklichen› Macht – die Partei oder/und der ‹revolutionäre Staat› - wurde die Poder Popular diesen unterworfen. In Venezuela wird Poder Popular, im Gegensatz zu anderen vorangehenden revolutionären Prozessen nicht als Interimsetappe verstanden, sondern als Weg und Ziel. Im Unterschied zu anderen Revolutionen fand in Venezuela aber keine Zerstörung der alten Strukturen statt, was die Schaffung und Ausbreitung von Strukturen der Poder Popular gefördert hätte. Und Poder Popular kann, aus der eigenen Logik heraus, nicht von oben verliehen werden. Poder Popular kann also nicht vom Staat aus verstanden werden, aber auch nicht ohne ihn. Es ist die Frage der Souveränität, zum Beispiel die Kontrolle der Ressourcen, die dazu zwingt, die Frage des Staates in die Poder Popular zu integrieren, auch wenn der Staat mit dem gesamten historischen Ballast des Repräsentation, Nationalismus, Ausschluss, Zentralismus, Institutionelle Politik, Teilung der Sphären usw. daher kommt.
Die Kommunalen Räte
Den am weitesten entwickelten Mechanismus zur Räte-Selbstorganisierung und die wichtigste Organisationsform auf lokaler Ebene stellen die Kommunalen Räte dar. Die aktivsten Akteure des Wandels in Venezuela waren und sind die BewohnerInnen der städtischen Armenviertel und bäuerlichen Gemeinden. Die Errichtung von Fabrikräten hat sich hingegen weitaus schwieriger gestaltet. Dies ist unter anderem auch auf die historisch-strukturell geringe Identifikation mit der industriellen Fabrikarbeit zurückzuführen.
Der Aufbau von Kommunalen Räten begann 2005 ohne gesetzliche Grundlage und als Initiative von unten. Im Januar 2006 nahm Chávez die Initiative auf und begann sie zu verbreitern. Im April desselben Jahres verabschiedete die Nationalversammlung ein Gesetz für die Kommunalen Räte. In der Regel bestehen diese Räte in städtischen Gebieten aus etwa 200 bis 400 Familien. Das Fundament und zentrale Entscheidungsorgan der so genannten CoCos (Consejos Comunales) sind die Nachbarschaftsversammlungen. Sie stellen eine nichtrepräsentative Parallel-Struktur zu den aus allgemeinen Wahlen hervorgehenden Institutionen der konstituierten Macht dar. 2009 gab es in ganz Venezuela etwa 30.000 Kommunale Räte.
Die Räte werden im Wesentlichen direkt durch den Staat und seine Institutionen finanziert, um so eine größere Einmischung der Bürgermeister und Rathäuser zu vermeiden, was sich in vorherigen Ansätzen als bedeutendes Problem herauskristallisiert hatte. Das Gesetz schreibt keiner Institution die Macht zu, Projekte, die von den Räten vorgeschlagen werden, abzulehnen. Tatsächlich ist die Beziehung zwischen den Räten und den Institutionen aber nicht gerade harmonisch. Die Konflikte entstehen vor allem aufgrund der starken zeitlichen Verzögerungen institutioneller Antworten und der Versuche institutioneller Einmischung.
Die Räte tendieren ihrer Struktur nach dazu, die Trennung zwischen politischer Gesellschaft und Zivilgesellschaft, das heißt den Unterscheid zwischen Regierenden und Regierten, zu überwinden. Besonders aus diesem Grund bewerten vor allem die Anhänger liberal- demokratischer Ideen, die diese Trennung unterstützen, die Räte negativ. Sie argumentieren, dass die Räte keine unabhängigen zivilgesellschaftlichen Kräfte sind, sondern Überschneidungen mit dem Staatsapparat aufweisen. Ohne Zweifel: Es handelt sich ja um den Aufbau einer Parallelstruktur, die nach und nach die Staatsmacht an sich nehmen soll, um sich schließlich selbst zu regieren.
Mehrere kommunale Räte können sich zu einer Comuna und mehrere Comunas und Räte schließlich zu einer ‹Kommunalen Stadt› zusammenschließen. Auf welcher Grundlage die Kooperation stattfindet und welche Aufgaben die Comunas übernehmen, entscheiden diese selbst. Die Strukturen beruhen weiterhin auf den lokalen Versammlungen und besitzen keine repräsentativen Mechanismen. Ende 2009 gab es etwa 200 Comunas im Aufbau. Die Idee der Comuna als Ort des Aufbaus der Partizipation, der Selbstregierung und des Sozialismus verweist auf die kommunistische Kommunentradition, auf die Pariser Kommune, aber auch auf Lateinamerikaner wie Simón Rodríguez, José Carlos Mariátegui und die historischen indigenen und afro-amerikanischen Erfahrungen.
Die Widersprüche und Spannungen auf dem Weg
Die Widersprüche auf dem Weg des Aufbaus von Poder Popular und des Aufbaus ‹von oben› und ‹von unten› sind zahlreich. Die Asymmetrie der Macht zwischen dem Staat und dem ‹von unten› kann leicht dazu führen, dass es die staatlichen Institutionen und ihre ‹Repräsentanten› sind, die politischen Einfluss auf die Initiativen ‹von unten› nehmen und nicht andersherum, so dass die Basisbewegungen Gefahr laufen, kooptiert zu werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die neue Institutionalität ‹von unten› Formen und Logiken der konstituierten Macht reproduziert, so wie hierarchische Strukturen, repräsentative Mechanismen, die Spaltung in ‹Führer› und ‹Geführte› oder Bürokratisierung.
Die Erfahrungen mit den Regierungspolitiken zur Unterstützung der Basisorganisierung sind sehr unterschiedlich und auch immer von den bereits existierenden Vorerfahrungen und dem jeweiligen Gegenüber in den öffentlichen Institutionen abhängig. Es gibt Erfahrungen, die von Paternalismus und Klientelismus geprägt sind, andere, in denen sich die Partizipation auf einen kleinen Kern von Leuten ohne wirkliche Basismobilisierung beschränkt, aber eben auch solche, in denen es wirklich gelungen ist, eine gemeinschaftliche Basisorganisation zu fördern, und das Ausmaß der Autonomie gegenüber den Institutionen zu vergrößern.
Es ist auch offensichtlich, dass der venezolanische Staat gestärkt werden muss, um die Souveränität durchzusetzen und die sozialen Rechte zu befriedigen. Das gerät aber mit der normativen Orientierung in Konflikt, den Staat zu überwinden und die Stärkung bringt auch die Gefahr mit sich, noch stärker korrupten, korporativen und bürokratischen Praxen zu verfallen, anstatt sie zu überwinden. In diesem Kontext ist auch die staatliche Finanzierung der Organisationen und öffentlichen Initiativen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ermöglicht dies zahlreiche Initiativen erst und unterstützt die Selbstorganisierung. Gleichzeitig hemmt es jedoch die Selbstorganisation von unten, da Abhängigkeitsverhältnisse die Tendenzen zum Klientelismus verstärken.
Die Diskrepanz zwischen Diskurs und Realität ist offensichtlich, was nicht unbedingt negativ sein muss, solange die Realität offen bleibt und sich weiter am Diskurs orientiert. Der Diskurs muss zwangsweise der Realität voraus sein, ohne allerdings den Kontakt mit ihr zu verlieren, ansonsten kann keine Debatte, Entwicklung oder Perspektive entstehen. In vielen Bereichen zeigt sich diese Offenheit, vor allem die kommunalen Räte besitzen das Potenzial eines kontinuierlichen konstituierenden Prozesses. Es gibt jedoch auch gegenteilige Tendenzen. Die Zukunft bleibt offen. Es ist nicht wenig, was in den letzten Jahren in Venezuela erreicht worden ist hinsichtlich der Verbesserung der Lebensbedingungen und des Aufbaus eines «Geflechts der Jetztzeit» (Walter Benjamin), das auf die Gesellschaft, die gesucht wird, verweist. Dennoch ist es noch ein weiter Weg zu einer gerechten Gesellschaft und es bleibt abzuwarten, ob die politischen, materiellen und empirischen Tendenzen der letzten Jahre sich in Zeiten der Krise bewahren lassen.
«Ich bin arbeitslos, aber ich bin aktiv. Ich weiß, was los ist, ich habe einen Consejo, ich habe jemanden, dem ich Rechenschaft ablegen muss, also das sind schöne Sachen. Lebendig sein ist genau das: aktiv sein, partizipieren. » Felipe Ocaríz, Consejo Comunal ‹Benito Juárez›, alleinstehend, arbeitslos
«Die Leute eignen sich das an, wir haben jetzt ein so großes Niveau an Bewusstsein. Wir haben hier die Erfahrung mit einem Militär, der einen Consejo Comunal aufbauen wollte, aber er bestimmte, wer dazugehörte. Die Bauern aus der Region sind bis hierher gereist und haben ihn angezeigt. In Maracaibo gab es eine richtige Auseinandersetzung mit Steinen, Knüppeln und Flaschen. [...] Die comunidad, das Pueblo, lässt sich diesen Prozess nicht entreißen.» Alexis Delgado, Ministerium für Partizipation und soziale Entwicklung (Minpades), Arbeitsbereich Consejos Comunales
«Viele Leute glauben nicht einmal an sich selbst, da liegt unsere Herausforderung. Für mich ist das Wenige, das erreicht wurde, einiges. Trotz allem müssen wir weiterhin das Paradigma ‹Ich glaube nicht› zerstören. Die Leute müssten verstehen, dass der einzige Weg, all das zu verändern, über die Partizipation geht und nicht, dass andere für dich entscheiden.» Carlos Hernández, Wirtschaftskomitee Consejo Comunal ‹Benito Juárez›,alleinerziehend mit zwei Kindern, arbeitet als Kameraassistent
«Ich bin verliebt in diesen Prozess, das ist etwas Unglaubliches, aber manchmal sage ich mir, ich ziehe mich zurück, weil die Institutionen nicht funktionieren wie sie sollten. Es ist unglaublich, welche Unfähigkeit herrscht, sie sind arbeitsunfähig. [...] Wer hier wirklich den Prozess an der Hand führt, das ist die Basis.» Jacqueline Ávila, Finanzbeauftragte im Consejo Comunal ‹Emiliano Hernández›, alleinerziehend mit zwei Kindern, Sozialpromotorin
«Eine sehr schöne Erfahrung, die wir gemacht haben, war mit dem Supermarkt, der hier unten eröffnet wurde. Die Junta Parroquial und die Jefatura Civil genehmigten ihn ganz schnell, aber sie sagten ihnen: «Geht zum Consejo Comunal, denn der hat das letzte Wort». Das sollte eigentlich nicht so sein, es sollte das erste und das letzte Wort sein, denn wenn du schon die Genehmigung in der Hand hast, wie kann man dir dann Nein sagen, sie haben ja schon gebaut. Also haben sich die vom Supermarkt drei Abende lang mit den Hauptsprechern getroffen und dann mit der Asamblea der Comunidad. Sie haben ihre Baupläne mitgebracht und wir haben gefordert, dass der Bau kleiner wird und sie einen Parkplatz bauen, für die Warenanlieferung, da sonst die Straße blockiert und verdreckt wird. Sie haben zusätzlich die Reinigung der Umgebung sowie Beleuchtung und Sicherheit für den Sektor zugesagt, was mehr oder weniger funktioniert hat. Um ihren Laden öffnen zu können, haben sie sich um das alles gekümmert und der Comunidad Unterstützung zugesagt.» Maria Valdéz, Wohnungskomitee, alleinstehend, verrentete Lehrerin
«Es waren 100 Häuser, aber wir schafften es, 170 zu reparieren. Warum? Weil nicht einfach Schecks verteilt wurden, sondern es gab eine Versammlung, auf der sich der Consejo Comunal verpflichtete, das Material für jedes Haus zu kaufen und die Arbeit des Maurers zu bezahlen. So wurde hier gearbeitet. Und jedes Haus gemäß der Bedürfnisse, denn wenn hier jemand dachte, für eine Tür Millionen zu bekommen: Nein! Wenn es eine Tür ist, ist es eine Tür, wenn es ein Fenster ist, dann ist es ein Fenster, und wenn wir das Dach erneuern müssen, dann ist es das Dach. So wurde es gehandhabt und es blieb Geld über und wir konnten 70 Familien mehr in das Programm integrieren.» Jacqueline Ávila, Finanzbeauftragte im Consejo Comunal ‹Emiliano Hernández›, alleinerziehend mit zwei Kindern, Sozialpromotorin
«Das ist eine Anfangsetappe, aber vielleicht wirst du noch sehen, wie hier nur noch Consejos Comunales existieren, denn wir haben schon Autonomie und wir werden dafür sorgen, dass das gut läuft.» Wilson Moya, Finanzbeauftragter Consejo Comunal ‹Emiliano Hernández›, verheiratet mit drei Kindern, Automechaniker
«Vielleicht bin ich dann schon gar nicht mehr im Consejo Comunal, aber ich will, dass diese Comunidad selbsttragend ist, das wir nicht von den Institutionen abhängig sind, um ein Problem der Comunidad zu regeln. Es ist sehr schlecht, von jemandem oder etwas abhängig zu sein. Deswegen wollten wir nicht, dass es eine Kooperative wird, denn die Kooperative zahlt ihren Kredit, und das war es! Wenn das aber im Consejo Comunal weiter läuft, wenn es etwas vom Consejo Comunal ist, dann werden die Einnahmen genutzt, um das Personal zu bezahlen, und der Rest kommt in einen Fond der Comunidad, um Notwendiges zu finanzieren. Das wird weiterhin mein Kampf sein, dass wir nichts und niemanden anbetteln müssen, sondern dass wir selbst den Willen und die ökonomische Kraft haben.» Evangelina Flores, Finanzkomitee Consejo Comunal ‹Unidos por el Chapulún›, verheiratet mit drei Kindern, Sekretärin, Sozialpromotorin
«Die Veränderung ist sehr groß – sie wieder rückgängig zu machen geht nicht. Die Leute äußern ihre Ideen, gehen auf Versammlungen, es gibt Konfrontation, die verschiedenen Ideen sind erlaubt, man sieht wie die Leute partizipieren. Vorher war das nicht so, vorher blieben wir eingeschlossen in unseren Häusern, egal was geschah, niemand tat irgend etwas, weder für die Comunidad, noch für den Nachbarn.» Amelia Lara, Sicherheitskomitee Consejo Comunal ‹Benito Juárez›, alleinstehend, verrentete städtiche Angestellte
«Die Partizipation, auch wenn wir mal nicht übertreiben sollten, ist schon flüssiger geworden. Um ein kleines Treffen abzuhalten musste man früher eine Woche mit dem Megafon herumlaufen, Zettelchen verteilen, mit den Leuten sprechen, und komm’ mal her, das und das ist los, und die Leute kamen in guter Anzahl, 70-85 Personen. Jetzt verteilst du ein paar Zettelchen, läufst kurz mal so halb mit dem Megafon herum und die Leute kommen. Ich bin baff gewesen wie an dem Tag als die Asamblea zur Solvencia Moral des Benito Juárez war, mehr als 80 Personen in dem Häuschen waren. Das schien mir ziemlich gut, ziemlich partizipativ und ohne viel Mühe.» Felipe Ocaríz, Consejo Comunal ‹Benito Juárez›, alleinstehend, arbeitslos
«Diese Revolution ist mehr für die Frauen – ich wollte dir noch erzählen, dass die Männer sauer sind, weil die Frauen jetzt kommen und sagen, «Schau, ich komme gleich wieder, ich gehe zu einer Demo und muss das und das machen» und die Männer bleiben zu Hause.» Petra Rivas, Consejo Comunal ‹Emiliano Hernández›, lebt mit Partner und drei Kindern, Friseurin