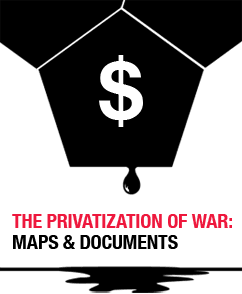Linke Perspektiven: «Ich weigere mich, eine Ware zu sein»
Eduardo Galeano, 1940 in Montevideo, Uruguay, geboren, gilt als einer der bekanntesten politische Essayist Lateinamerikas. Weltberühmt wurde er mit seinem 1971 erschienenen Buch «Die offenen Adern Lateinamerikas», einer engagierten Analyse der Ausbeutung und Unterdrückung Lateinamerikas durch Kolonialismus und Neokolonialismus von der Eroberung des Subkontinents durch die Spanier bis zur konterrevolutionären Politik der USA in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts. Das Buch trug zur Politisierung einer ganzen Generation bei, noch heute wird es als Standardwerk betrachtet. Nach dem Militärputsch in Urugay 1973 musste Galeano fliehen, und setzte er seine Geschichtsschreibung «von unten» mit dem dreibändigen Werk «Erinnerung an das Feuer» im Exil fort. Heute setzt er sich in seiner Heimat für demokratische Reformen ein. Ein Interview mit Galeano in unserer Serie «Linke Perspektiven».
Am Ende dieses Jahrhunderts klaffen die sozialen Widersprüche weltweit auseinander wie nie zuvor. Sind wir Gefangene eines Systems, das die Menschheit unausweichlich zugrunde richtet?
Dracula hat bestimmt grosse Minderwertigkeitskomplexe. Denn er fühlt sich heute wie der letzte Dreck und glaubt, seine ganze Arbeit sei nichts wert, wenn er sieht, wie die multinationalen Konzerne agieren und wie die wilden Mechanismen der grossen Finanz und Handelsmärkte der Welt funktionieren, die dir mit der einen Hand das leihen, was sie dir mit der anderen stehlen. Es stimmt, dass das System sehr zerstörerisch mit den Menschen und der Natur umgeht, und es herrscht eine traurige Konkurrenz, vor allem unter den Ländern des Südens, um in den Zeiten der Globalisierung Kapital anzuziehen. «Wer kriecht am besten», heisst das Motto. Angeboten werden absolut niedrige Löhne und die Freiheit, die Umwelt zu verschmutzen. Es ist ein System, das die Menschen zur Einsamkeit, zur Angst, zur Hoffnungslosigkeit und zu Beklemmungen verurteilt. Es zerstört die solidarischen Beziehungen zwischen den Menschen. Es zwingt uns, die anderen als Feinde zu betrachten. Es überzeugt uns davon, dass das Leben eine Rennbahn ist, auf der es wenige Gewinner und viele Verlierer gibt. Es ist ein System, das die Seele vergiftet. Es gibt eine Usurpation der Ziele durch die Mittel. Wir fragen kaum noch nach dem Warum, weil wir mit dem Wie so beschäftigt sind. Wir sind Gefangene des Wie. Aber wir müssen das verlorene Gefühl, das Leben für den Genuss zu leben, zurückgewinnen.
Der Pessimismus, der die Welt und die Linke erfasst hat, gründet sich auf die historische Erfahrung des Scheiterns der realsozialistischen Systeme. Mangelt es an einem glaubwürdigen alternativen Projekt der Linken?
In gewisser Hinsicht herrscht Symmetrie - in dem Sinn, dass im Westen die Gerechtigkeit im Namen der Freiheit geopfert wurde und im Osten die Freiheit im Namen der Gerechtigkeit. Im Grunde geht es um die Wiedergewinnung dieser verlorenen Einheit. Die Freiheit und die Gerechtigkeit, die als Zwillinge geboren und gewaltsam getrennt wurden, müssen wieder zusammenfinden. Das ist es, was ich wünsche. Genauso wie die Wiedergewinnung der Einheit von der Gerechtigkeit und der Schönheit ein Teil der Utopie ist. Möglicherweise war die Ethik noch nie so getrennt von der Ästhetik wie heute.
Sie haben in Ihren Essays von der Notwendigkeit der Entgiftung des Geistes gesprochen, gibt es ein Rezept für das Gegengift?
Nein. Glücklicherweise, denn ich glaube an kein Rezept. Aber ich glaube an das Recht auf Notwehr. Wenn sich jemand durch eine dominierende Kultur bedroht sieht, die den Geist vergiftet und ihn mit Gewalt und Angst füllt, dann hat er jedes Recht, sich dagegen zu verteidigen. Und wenn es eine dominante Kultur gibt, die deine Identität ausradiert, dann hast du jedes Recht, sie zu bekämpfen. Ich glaube, dass das menschliche Wesen geheime Muskeln besitzt, die es ihm erlauben, besser zu sein als dieses abscheuliche Bild, das einem jeden Tag von einem System um die Ohren gehauen wird, das auf Geld konzentriert ist. Wir sind viel mehr als Geld. Es ist am Ende dieses Jahrhunderts zu einer Universalisierung der Verehrung des Geldes gekommen. Die Werte eines Systems, das auf Habsucht basiert und alle Menschen und Länder zu Waren reduziert, sind auf den höchsten Altar gehoben. Ich weigere mich, eine Ware zu sein. Und ich weigere mich zu akzeptieren; dass das, was keinen Preis hat, auch keinen Wert besitzt. Schon, in den 30er Jahren sagte der Dichter Antonio Machado, dass so mancher Depp Preis und Wert verwechsele. Über ein halbes Jahrhundert später verwechselt dies fast jeder. Daher ist unsere Selbstachtung so niedrig in Lateinamerika, denn was wir verkaufen, ist immer weniger wert, und infolgedessen sind wir es auch. Ich glaube, dass Land und Leute mehr als nur Waren sind.
Genau das Gegenteil meinen die internationalen Finanzinstitutionen, die gerade in Lateinamerika eine dominierende Rolle einnehmen. Wie beurteilen sie lWF und Weltbank?
Der IWF ist eine weltweite Maschine im Dienste der Idee der Entwicklung, eine Art Weltregierung, weil seine Funktionäre mehr vermögen als alle Wirtschaftsminister zusammen. Wenn die Leute einen Präsidenten wählen und er seine Minister bestimmt, sind wir Zuschauer eines Theaterstückes. Denn diejenigen, die eigentlich herrschen, sitzen irgendwo am Schreibtisch, und von dort entscheiden sie per Computer das Schicksal von Millionen. Sie konzentrieren den Reichtum und setzen die massive Verarmung durch. Und das bei absoluter Straflosigkeit. Das nennen sie Strukturanpassungsprogramme. Die Logik der Entwicklung und des Wirtschaftswachstums ist absurd. Wenn Waffen verkauft werden, steigt das Bruttosozialprodukt. Das ist eine gute Nachricht im Wirtschaftsteil der Zeitungen. Aber ist es eine gute Nachricht für die Opfer dieser Waffen? Wenn ein Haus einfällt oder ein Flugzeug mit allen Insassen abstürzt, ist das für die Wirtschaft eine gute Nachricht. Nicht nur weil die Auszahlung der Versicherungssumme Geld bewegt, sondern auch weil ein neues Gebäude oder ein neues Flugzeug gekauft werden muss. Für die Wirtschaft ist das gut, aber für die Opfer? Eine Freundin, die als Sozialarbeiterin tätig ist, erzählte mir kürzlich, dass sie ein Haus betreiben, in dem sich Kinder im Alter von neun Jahren aufhalten, die Drogen zu sich nehmen. Sie betäuben sich mit Klebstoff. Einer der Jungen sagte zu ihr, sie solle nicht böse auf ihn sein. «So gehe ich in ein anderes Land», erklärte er. Er nimmt Drogen, um zu fliehen, und das passiert mit Millionen von Kindern. Er möchte dieses traurige Land verlassen, in dem wir leiden und das zu einem grossen Teil durch die Knebelungen der internationalen Finanz- und Kreditinstitutionen so geworden ist.
Aber die Flucht vor der Realität ist nicht die einzige Antwort. Welche Kräfte leisten heute in Lateinamerika Widerstand?
Ein interessantes Beispiel für eine neue Bewegung gegen den Neoliberalismus ist die in Europa weitgehend unbekannte Organisation El Barzon. In ihr haben sich in Mexiko über zwei Millionen Kleinschuldner zusammengefunden, die ihre Schulden und die enorm angestiegenen Zinsen nicht mehr an die Gläubigerbanken zurückzahlen können und wollen. Damit treffen sie das Finanzsystem in seinem Nervenzentrum. Kürzlich wurden Repräsentanten von El Barzon sogar vom Vizepräsidenten der Weltbank in Washington empfangen. Ein deutlicheres Zeichen für die Furcht der Mächtigen vor dieser sich schnell entwickelnden Bewegung kann es nicht geben. Andererseits haben in Mexiko auch die Zapatistas aus Chiapas mit ihrem Aufstand im Januar 1994 ein Zeichen der Hoffnung gesetzt. Es gibt in Lateinamerika viele Kämpfe gegen den Neoliberalismus, von denen nichts oder nur wenig bekannt ist, weil die grossen Medien darüber nicht berichten. Nehmen Sie zum Beispiel mein Land Uruguay. Kaum jemand weiss, dass es hier vor sechs Jahren eine Volksabstimmung über die Privatisierung gab. 73 Prozent der Bevölkerung stimmten dagegen, woraufhin alle Gesetze über die Privatisierung zurückgezogen werden mussten. Das erscheint mir eine wichtige Nachricht. Den Staat sollte man nämlich nicht privatisieren, sondern im Gegenteil deprivatisieren. Denn statt dem allgemeinen Interesse zu dienen und Ausdruck der kollektiven sozialen Interessen zu sein, ist er heute Ausdruck des Interesses einer kleinen Minderheit, die den Staat usurpiert hat und die öffentlichen Rechte in Privilegien der Macht verwandelt.
Das aufsehenerregendste lateinamerikanische Medienereignis in der letzten Zeit war die Besetzung der japanischen Botschaft in Lima durch ein Kommando der MRTA und deren Erstürmung. Wie haben Sie diese Geschehnisse wahrgenommen?
Mit dem Massaker bei der Räumung hat der peruanische Präsident Fujimori auf eine abscheuliche Weise die Leute bestraft, die die Botschaft besetzt hielten. Aber was ist mit ihm, der das Parlament und die Exekutivgewalt mit einem selbstinszenierten Staatsstreich besetzt hat? Was ist schon das Verbrechen, eine Botschaft zu besetzen, im Vergleich zu dem Verbrechen, ein Parlament zu besetzen und es aufzulösen!
Nicht nur die sozialen und politischen Folgen des Neoliberalismus beschäftigen Sie, sondern auch die ökologischen. Sie sagten einmal, es gelte, die verlorengegangene Einheit von Mensch und Natur zurückzugewinnen. Wie stellen Sie sich das vor?
Es gibt zwei Faktoren, die die Auslandsinvestitionen anziehen: die Freiheit, die Natur ungestraft zu verschmutzen und zu zerstören, sowie das Recht, einen Dollar pro Tag als Lohn zu bezahlen. Die Resultate für die Welt sind immer katastrophaler. Fünf Jahre nach der internationalen Umweltkonferenz in Rio, die die Welt mit Worten und Absichtserklärungen überschwemmte, scheint mir der Tod von Jacques Cousteau die beste Metapher für eine Bilanz zu sein: Er starb in dem Moment, in dem die Unfähigkeit des Systems, einen in eine Kloake verwandelten Planeten zu retten, am offensichtlichsten geworden ist. Wir müssen wieder auf unsere tiefsten kulturellen Wurzeln schauen. Für die amerikanischen indigenen Kulturen bildet der Mensch eine Einheit mit der Natur, weil er Teil von ihr ist. Und weil sie das glaubten, wurden die Indigenas seit dem 16. Jahrhundert bestraft. Sie wurden wegen «Götzenverehrung» verfolgt, weil sie glaubten, dass die Natur heilig sei. Das galt als Beweis für die Präsenz des Teufels. Später wurde die Natur als wildes Tier gesehen, das gezähmt und unterworfen werden muss, um im Dienste des, wie der herrschende Machismus es nennt, Menschen zu stehen. Erst in den letzten Jahren ändert sich etwas. Heute spricht man nicht mehr davon, die Natur zu beherrschen, die Parole lautet vielmehr, sie zu beschützen. In beiden Fällen aber gehen wir von einer falschen Grundannahme aus, indem wir die Natur ausserhalb von uns selbst ansiedeln. Wir müssen diese verlorene grundlegende Einheit wiedergewinnen, die die unterworfenen indigenen Völker besassen. Für sie war diese Trennung unmöglich. Wir müssen den Blickwinkel verändern, und das gilt für viele Probleme.
Was meinen Sie damit konkret?
Ich glaube, dass es in jedem Fall eine interessante kreative Übung ist, den Blickwinkel zu wechseln. Was passiert dabei? Ich versetze mich in die Position, von der aus ein anderer mich wahrnimmt, und das ergibt eine viel realistischere Sicht auf die Dinge. Stellen Sie sich Kolumbus aus dem Blickwinkel der Indios vor: ein Mann mit einem roten Hut und einem grossen Umhang aus violettem Samt. Ich glaube, für die Indios dürfte er wie ein grosses Exemplar einer bestimmten Papageienart ausgesehen haben. Oder nehmen Sie die Drogenproblematik. Aus dem vorherrschenden Blickwinkel der Medien wird Kolumbien verurteilt, dem Konsummarkt hingegen wird Absolution erteilt. Die Droge ist nordamerikanisch als Tragödie und Geschäft. Aber in den Augen der Welt ist sie eine kolumbianische Krankheit. Wie ist es nur möglich, dass man eine Mücke am Horizont zu fotografieren vermag, aber kein einziges Flugzeug, das die Drogen in die USA bringt, festhalten kann? Wie sind die Straflosigkeit im Drogengeschäft, mit der innerhalb der USA operiert wird, und gleichzeitig die Hexenjagd ausserhalb der USA möglich? Ebenso ist es mit anderen Produkten. Die Ökonomen sagen, dass nur ein Prozent des Verkaufspreises von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus dem Süden bei den Produzenten ankommt. Auch die Produzenten von Marihuana oder Kokain erhalten nur ein Prozent des Verkaufspreises. 99 Prozent verdienen die Zwischenhändler, normalerweise grosse Zwischenhändler, die in keinem Polizeibericht vorkommen. Da das Drogengeschäft ausserordentlich lukrativ ist, bleibt es auch illegal. Es ernährt sich durch sein Verbot. Dasselbe war beim Alkoholgeschäft während der Zeit der Prohibition in den USA zu beobachten. Als der Alkohol legalisiert wurde, sanken die Gewinnspannen enorm. Für mich sind nicht die Drogenproduzentenländer verantwortlich. Produziert der eine nicht, tut es der andere. Genau das ist es, was die Neoliberalen sagen. Es ist das Herz der neoliberalen Doktrin. Auf eine Nachfrage reagiert der Markt mit einem Angebot. Wenn es Bedarf gibt, kann diesen kein Verbot unterbinden. In diesem Sinn sind die Drogenhändler geradezu Vorzeige-Neoliberale.