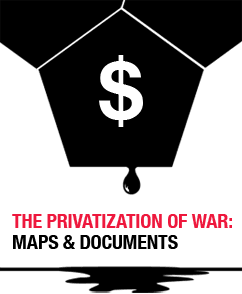Die Kampagne der EZLN stärkt die mexikanische Linke
Auf in die Hauptstadt!
Seit Ende Februar reist eine Delegation der EZLN quer durch Mexiko, um am 10. März in Mexiko-Stadt einzutreffen. Die Zapatistas wollen dort, so die offizielle Begründung, den Kongress-Abgeordneten ihren Standpunkt zu der Gesetzesinitiative über »indianische Rechte und Kultur« darlegen. Doch der wirkliche Grund für die Reise dürfte in dem Versuch liegen, die sozialen Bewegungen zu stärken und für eine neue Mobilisierung der Linken zu sorgen.
Dieses Vorhaben kann nur als gelungen bezeichnet werden, nutzen die Zapatistas ihre Reise doch dazu, ihre politischen Vorstellungen direkt und ungefiltert der Bevölkerung mitzuteilen. Wo die Comandantes auch auftreten, werden sie von Zehntausenden begeisterter Anhänger empfangen. Der Trip in die Hauptstadt ist in das Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gelangt und die mexikanische Linke findet dadurch zu einer gewissen Stärke zurück.
Allerdings ist die jetzige Kampagne auch nicht der erste Versuch der EZLN, eine landesweite Dynamik zu bewirken. Da sich aber in der Vergangenheit die indianischen Organisationen als einzig verlässliche politische Kraft erwiesen haben, rückte die Forderung nach Autonomie in den Mittelpunkt.
Die hier von einigen Deutschen geäußerte Kritik, die EZLN konstruiere ethnische Subjekte, zeugt nur von Unkenntnis. In der Autonomie-Forderung der Zapatistas entsteht die Inanspruchnahme gewisser Rechte ausschließlich aus der Selbstzuschreibung. Zudem ist der Begriff eng an die »Gemeinschaft« gekoppelt: Autonomie ist demnach eine Befugnis und ein universelles Recht aller, sich selbst als Teil einer Geschichte, einer gemeinsamen Vergangenheit und klar definierter Bestrebungen anzuerkennen. Dabei handelt es sich also gerade nicht um ein rückwärtsgewandtes Projekt der Traditionspflege. Vielmehr sollen die vergangenen Erfahrungen mit den politischen und kulturellen Erlebnissen von heute kurz geschlossen werden, um ein Projekt für die Zukunft zu schmieden.
Um der Autonomie eine konkrete Form zu geben, bedarf es - außer der politischen Bewegung zu ihrer Durchsetzung - einer entsprechenden juristischen Verankerung. Dazu dient das 1996 unterzeichnete Abkommen von San Andrés »über indianische Rechte und Kultur«. Das mag reformistisch erscheinen, ist aber, so lange der bürgerliche Staat existiert, nicht ganz unwesentlich.
Gemäß der Vorlage folgt der Anerkennung der indianischen Gemeinschaften als Rechtssubjekte die Anerkennung ihrer kollektiven Rechte. Dabei geht es nicht um weitreichende individuelle Rechte - diese sollen, so die Organisationen des Nationalen Indígena-Kongresses (CNI), für alle Menschen, also auch für Nicht-MexikanerInnen, gelten. Kollektive Rechte bilden lediglich den Rahmen, in dem die individuellen Rechte ausgeübt werden können.
Hier liegt die Wurzel des Konflikts, da diese Formel selbstverständilich auch das Recht umfasst, eigene gesellschaftliche Organisationsformen herauszubilden. Außerdem beinhaltet sie das Recht, die eigenen Normen in juristischen sowie Eigentumsfragen, im Bildungs- und Gesundheitssektor umzusetzen.
Das aber ist mit dem hegemonialen - und damit homogenisierenden - Anspruch eines modernen bürgerlichen Staatsverständnisses unvereinbar, basiert dieses doch auf der Vorstellung der Untrennbarkeit der Kategorien Nationalstaat/Territorium und einem universellen Normsystem. Die Existenz verschiedener Normsysteme auf einem Territorium bei gleichzeitiger Selbstzuordnung zu den Normsystemen steht im Widerspruch zu dem Allmachtsanspruch des modernen Staates.
Angesichts dessen ist auch die in einigen - vor allem deutschen - Kreisen erhobene Kritik, die Autonomieforderung stelle einen bürgerlichen Reformansatz dar, unverständlich. Zudem geht sie an der Realität vorbei und zeugt nur von einem quasi-religiösen Politikverständnis. Die Option Reform oder Revolution ist in dieser Form falsch: Die Entscheidung hängt nicht von den subjektiven Wünschen oder dem Willen Einzelner ab, sondern vom Kräfteverhältnis und dem gesellschaftlichen Klima. Reformen oder Revolutionen sind ein Resultat der objektiven Verhältnisse. Eine solche Kritik kann nur aus einer Position geäußert werden, die die Priviligien bürgerlicher Rechte genießt.
Auch die Verbesserung der Situation von AsylbewerberInnen oder MigrantInnen in Deutschland ist nicht revolutionär. Soll sie deshalb abgelehnt werden? Von bürgerlich-naiven Vorstellungen zeugt viel eher das Ideal der republikanischen Bürger, die unabhängig von ihrer Herkunft vor dem Gesetz gleich sind.
Links zu diesem Artikel: