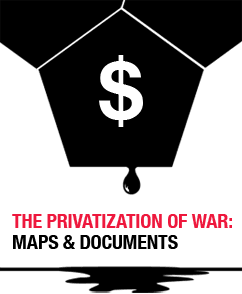Anhänger der mexikanischen Regierungspartei masskrieren 45 Tzozil-Indianer im Hochland bei San Cristóbal de las Casas
Blutige Weihnachten in Chiapas
Plötzlich kommt ein Lastwagen mit etwa 40 Männern, begleitet von einem Polizeifahrzeug, entgegen. Die Überlebenden aus Acteal erkennen mehr als ein Dutzend der Mörder ihrer Angehörigen wieder. Sie blockieren die Straße und versuchen, die Männer vom Lastwagen zu zerren. Um einen Aufruhr zu verhindern, greift die Seguridad Publica ein und rettet die Verdächtigen vor der aufgebrachten Menge ins Polizeifahrzeug.
Der Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung. Keine zwanzig Meter von dem Ort, an dem die meisten der 45 Toten den Schüssen der Paramilitärs zum Opfer fielen, schaufeln Dutzende von Männern seit dem frühen Morgen zwei große Massengräber. Dort werden auch die Särge aufgereiht. Leichengeruch liegt in der Luft.
Die mexikanische Tageszeitung La Jornada bezeichnet den Angriff auf das Dorf Acteal im Bezirk Chenalho im Hochland von Chiapas als das größte Massaker an Zivilisten seit 1968. Der etwa 70 Kilometer nordöstlich von San Cristobal de las Casas gelegene Bezirk hat in den letzten Monaten häufig für Schlagzeilen gesorgt: Chenalho, wo 30 000 Menschen verteilt auf 61 Gemeinden leben, ist seit August 1995 gespalten. Einerseits besteht die alte Verwaltung der Regierungspartei PRI weiter, andererseits eine autonome Gemeinde, die sich als zivile Unterstützungsbasis der EZLN versteht. Die von der PRI dominierte Verwaltung beruft sich auf die Wahlen vom Oktober 1995, zu deren Boykott die EZLN aufgerufen hatte, und bei denen die Wahlbeteiligung unter 25 Prozent lag. Beide Bezirksverwaltungen agieren seit nunmehr zweieinhalb Jahren parallel, wobei die autonome Verwaltung mit Sitz in Polho jegliche staatliche Hilfe ablehnt. Hinzu kommt noch eine dritte Gruppe im Bezirk Chenalho, die sich 1993 aus Protest gegen behördliche Willkür gegründet hat, die mit der autonomen Gemeinde zusammenarbeitet, sich aber nicht der EZLN zuordnen möchte und gegen jede Gewalt ausspricht. Sie nennt sich Sociedad civil Las Abejas. Ausnahmslos dieser Gruppe gehörten die Opfer von Acteal an.
Mit der Konstituierung der autonomen Gemeinde begann auch der Terror: Nach Informationen des Menschenrechtszentrums Fray Bartolomé de las Casas in San Cristóbal zwingen die PRI-Gemeindevorstände die ansässigen Familien, Schutzgelder zu bezahlen, von denen Waffen und Munition gekauft werden. In zahlreichen Gemeinden wurden BewohnerInnen, die derartige Maßnahmen verweigerten, vertrieben. Anfangs pflegten die Aggressoren, selbst die verlassenen Hütten zu beziehen und sich als reine PRI-Gemeinden neu zu konstituieren. Doch in den letzten Monaten eskalierte die Gewalt: Auf Plünderungen folgten immer häufiger Brandstiftungen und Morde. Bereits vor dem Massaker von Acteal hatte der Konflikt mindestens 29 Tote gefordert und es befanden sich im Bezirk Chenalho sechs- bis siebentausend Menschen auf der Flucht. Sie leben in notdürftig errichteten Flüchtlingslagern, unter Bananenblättern oder Plastikplanen, ohne Latrinen, gesundheitliche Versorgung und ausreichende Nahrung. Manche sind seit Monaten da, andere erst seit ein paar Tagen. Viele sind aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt erkrankt. Mehrere Kleinkinder sind in den letzten Tagen gestorben.
Paramilitärs schießen in Gottesdienst
Die autonome Gemeinde Polho verteilt die Hilfsgüter, die zuweilen mit LKW aus der Hauptstadt kommen. Einige der Lager sind jedoch nur zu Fuß auf langen Märschen durch den Schlamm zu erreichen. Polho, wo immer nur einige hundert Menschen lebten, hat mittlerweile etwa 5.000 Flüchtlinge zu versorgen.
Dieses Dorf, gleich neben der Gemeinde Acteal, war es, das die PRI-Anhänger gemeinsam mit Angehörigen des Partido Cardenista, einer von der PRI aufgebauten Scheinopposition, am 22. Dezember angegriffen haben. Gegen elf Uhr morgens gerade wurde in der kleinen Holzkapelle Kleidung vom Roten Kreuz verteilt, während einige der katholischen Abejas-Mitglieder für den Frieden beteten fielen die ersten Schüsse. Auf die Kapelle, in der und um die sich rund 350 Menschen drängten, ging ein Kugelhagel von zwei Seiten nieder.
Auch als der Trauerzug aus Polho drei Tage später in Acteal zur Beerdigung eintrifft, sind die Spuren noch gut zu erkennen: Berge von Kleidung in der panikartig verlassenen Kapelle, Einschußlöcher in den Holzplanken und Baumstämmen. Nur die Blutspuren an den Bäumen haben Militär und Polizei, die den Ort drei Tage lang besetzt und abgeriegelt hielten, zum Teil mit Machetenhieben abgeschält. Doch in einer Mulde am Hang, in der einige vor den Schüssen Zuflucht gesucht hatten, liegen noch blutgetränkte Kleidung und Tüten mit hastig zusammengerafften Sachen.
Hier, so erzählt ein Mann, habe er in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember gut dreißig Tote gefunden, die kreuz und quer übereinander lagen. "Ich stand oben an der Böschung vor diesem schrecklichen Bild und habe heruntergerufen, ob noch jemand lebt. Eine Frau hatte sich auf ein kleines Mädchen geworfen und es so vor den Kugeln geschützt, und zwei verletzte Frauen habe ich noch aus dem Leichenberg gezogen. Alle anderen waren tot. Die meisten Opfer hatten Einschußlöcher im Genick und im Rücken. Sie wurden aus etwa vier Meter Abstand, von oben, in der Mulde erschossen, in der sie Schutz gesucht hatten. Direkt an der Kante fand man die Patronenhülsen. Neun der Opfer waren Männer, alle anderen Frauen und Kinder, einschließlich eines Neugeborenen.
Polizei schaut weg
Bereits um 12 Uhr jenes 22. Dezember, also noch während des Massakers, haben italienische Fotografen aus der Ferne einen Polizeitransporter in Acteal fotografiert. Doch der örtliche Polizeichef, Comandante Jesús Rivas, will mit seinen Leuten erst vier Stunden später ins Dorf gekommen sein - zu dem Zeitpunkt also, an dem nach Aussage der Zeugen aus Polho die Detonationen geendet haben. Alles sei ruhig gewesen, so Rivas, die Menschen hätten sich bei seinem Eintreffen in den Häusern verschanzt und geweigert, mit ihm zu sprechen. Und obwohl die Kaserne der Polizei zwischen Polho wo jeder die Schüsse gehört hatund Acteal liegt, will die Polizei nichts derartiges vernommen haben. Mittlerweile ist allerdings bekannt, daß die Polizei nur zweihundert Meter von der kleinen Kirche entfernt stand und sich darauf beschränkte, ein paar Mal in die Luft zu schießen. Als dies die Angreifer mit roten Mützen und Halstüchern nicht abschreckte, überließen sie Acteal den Paramilitärs, der Mascara Roja. Diese benutzten Gewehre und Munition, die nicht frei verkäuflich und der Armee vorbehalten sind. Nachdem sie etwa eine Stunde lang auf ihre Opfer eingeschossen hatten, verbrachten sie weitere vier Stunden damit, sie mit Macheten zu verstümmeln. Einigen wurden Hände und Füsse abgehackt, schwangeren Frauen die Bäuche aufgeschlitzt, die Embryos herausgerissen und vielen Kindern die Köpfe aufgeschlagen.
PRI-Bürgermeister als Drahtzieher
Über eine Woche nach dem Überfall auf Acteal sind 39 Angreifer inhaftiert, darunter auch Jacinto Arias Cruz, der Bürgermeister des Bezirks Chenalhó. Er hatte am ersten Tag noch öffentlich geleugnet, daß es in Acteal Tote oder Verletzte gegeben habe. Doch die Anschuldigungen gegen den PRI-Bürgermeister sind eindeutig. Er soll Drahtzieher des Massakers und der seit Monaten anhaltenden Vertreibungen und Morde im Chenalhó sein. Arias Cruz, der über hervorragende Verbindungen zu der Regierung des Bundesstaates Chiapas verfügt, wird bisher lediglich "Anstiftung" zu dem Angriff vorgeworfen.
Inmitten einer Gruppe von Journalisten und Schaulustigen steht auf dem Hauptweg des Dorfes Polho "Luciano", der Repräsentant der autonomen Zapatistengemeinde und örtliche Verbindungsmann zur EZLN. Sein Gesicht spärlich mit einem Halstuch verdeckt, übersetzt er für die Presse immer neue Berichte von Augenzeugen aus dem Tzotzil. Unter Tränen erzählt Maria Perez Perez, wie Bürgermeister Arias Cruz am Samstag vor dem Massaker eine Versammlung einberufen habe, an der die Vorstände von fünf PRI-Gemeinden des Bezirks teilgenommen hätten. Dort habe er die Gemeindevorstände angewiesen, jeweils 25 bewaffnete Männer für den Überfall auf Acteal zur Verfügung zu stellen. Der Koordinator der Paramilitärs sei Tomas Mendez, ein ehemaliger Militär aus der Gemeinde Los Chorros, die auch als Zentrale der Paramilitärs bekannt ist. Von dem geplanten Angriff erfuhr Maria Perez Perez noch am Samstag von ihrem Ehemann, der Mitglied des Rates von Chenalhó ist. Die Tzotzil-Indianerin wollte daraufhin ihre Familie vor dem bevorstehenden Angriff warnen. Doch auf dem Weg wurde sie von der Polizei von Chenalhó verhaftet und verbrachte vier Tage im Gefängnis, wo sie von der Polizei geschlagen wurde und nichts zu Essen bekam.
"Mein Mann ist ein Mörder"
Juana Vasquez Perez, eine kaum zwanzigjährige Tzotzil-Indianerin aus Acteal, denunziert ihren eigenen Ehemann als Mörder und Paramilitär. Sie hält ein Foto hoch, wahrscheinlich ihr Hochzeitsfoto, von dem sie ihr eigenes Konterfei abgerissen hat. Zu sehen ist ein junger Mann. "Das ist er, Armando Vasquez Luna aus Quextic, er ist ein Mörder!" ruft sie erregt. Sie hat bei dem Massaker ihre Mutter und zwei Schwestern verloren. Nun ist sie zu ihrem Bruder nach Polho geflohen. Ihr Mann sei bei der PRI, berichtet sie, während der Großteil ihrer Familie zu Las Abejas und ihr Bruder in Polho zu der zivilien Unterstützungsbasis der EZLN gehöre. Da die Angreifer aus den Nachbargemeinden rekrutiert wurden, kann "Luciano" schon zwei Tage später eine komplette Namensliste aller 140 Männer verlesen, die an dem Massaker beteiligt waren.
In den Tagen nach dem Massaker von Acteal kamen Gerüchte auf, daß bewaffnete Gruppen 3.500 Flüchtlinge in einem weit abgelegenem Lager namens X'Cumumal umzingeln wollen. Eine parlamentarische Delegation der oppositionellen PRD aus Mexiko-Stadt hat in der Zwischenzeit gemeinsam mit dem Roten Kreuz und unter Militärbegleitung das Lager erreicht. Auf dem Weg kann die PRD-Delegation noch 400 weitere Flüchtende "befreien", die in zwei verschiedenen PRI-Gemeinden seit Wochen gefangengehalten und zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Doch die Situation in vielen Gemeinden ist nach wie vor unklar: Das Militär hat viele Straßen gesperrt, und auf den einsamen Bergpfaden fühlen sich mittlerweile nur noch die Paramilitärs sicher.