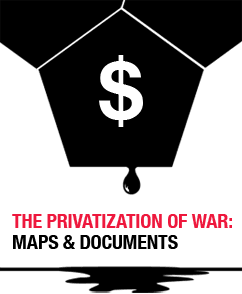Vor einem Jahr, am 22. Dezember 1997, stürmten regierungstreue Paramilitärs das kleine Dorf Acteal
Leben im Schatten der Toten
Vor einem Jahr, am 22. Dezember 1997, stürmten regierungstreue Paramilitärs das kleine Dorf Acteal im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Auf grausame Weise ermordeten sie 45 Frauen, Kinder und Männer. Die Opfer von Acteal gehörten einer Gruppe an, die sich 1993 aus Protest gegen behördliche Willkür gefunden hatte: der »Sociedad civil Las Abejas« (Bürgergesellschaft „Die Bienen“). Die Überlebenden des Massakers fristen heute ein trauriges Dasein inmitten eines militarisierten Gebiets.
Acteal ist ein geteiltes Dorf. Im oberen Teil befindet sich die Basis der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN), weiter unten stehen die Hütten der katholischen Organisation der Abejas. Den Namen erklärt einer der Dorfvorsteher: » . . . weil wir so für den Herrn arbeiten wie die Bienen für ihre Königin«. Feindschaft besteht zwischen beiden Teilen nicht, im Gegenteil, die Abejas haben sogar zwei Vertreter in den Rat des autonomen Landkreises von Polhó entsandt, den die EZLN-Basis ausgerufen hat. Und sie unterstützen die Forderungen der Zapatisten, ohne sich der EZLN zuordnen zu wollen.
Die Militärs kennen keine »Neutralen«
Am Eingang zum Unterdorf hängt ein Transparent, das jeden Fremden auffordert, sich auszuweisen. Doch niemand ist zu finden, bei dem dies möglich wäre. Die Frau aus einem kleinen Laden, die fast beiläufig erwähnt, sie habe bei dem Massaker neun Angehörige verloren, teilt mir nach einer halben Stunde mit, ich solle einfach mal ins Dorf gehen.
Das Oberdorf dagegen wird ständig bewacht und Besucher werden freundlich nach einem Ausweis gefragt. Danach kann der Rundgang beginnen - vorbei an Webstühlen und einer Baumwollfärberei, hin zu den vielen Flüchtlingen, die an neuen Behausungen bauen. Etwa 80 Prozent der 1000 Bewohner des zapatistischen Acteal sind Flüchtlinge, ebenso groß ist deren Anteil unter den 1200 Leuten im Acteal der »Bienen«.
Respektvoll und freundlich reden Anhänger beider Gruppierungen immer wieder als »Brüder und Schwestern« voneinander. Doch die Unterschiede sind deutlich: Die sehr religiösen »Bienen« lehnen jede Gewalt ab, würden sich selbst im Notfall nicht verteidigen und beharren darauf, neutral zu sein. Dabei kennen Paramilitärs und Armee nur »für uns oder gegen uns« und sortieren die Abejas als Feinde ein. Dem Massaker Ende 1997 waren Versuche der Paramilitärs vorausgegangen, die im Unterdorf zu Aktionen gegen die Zapatisten zu bewegen, doch die »Bienen« hatten sich geweigert, weiße Fahnen an ihren Häusern angebracht und Schilder mit der Aufschrift »neutrale Zone« aufgestellt.
Der Angriff auf das Dorf war angekündigt, die Zapatisten hatten ihre religiösen Brüder und Schwestern bewegen wollen, den Ort vorsorglich für einige Tage zu verlassen, die »Bienen« indes beschlossen, »zu bleiben und zu beten, damit nichts passiert«. Über dem Massengrab, in dem die Opfer des Massakers liegen, wird mittlerweile eine Kapelle errichtet - das einzige steinerne Gebäude im unteren Teil des Dorfes. Die Toten werden hier besser gebettet als die Lebenden. Im Innern der Kapelle, die wie eine kleine Lagerhalle aussieht, hängen die Fotos einiger Toter, nicht aller, denn viele wurden nie fotografiert. Zwei große Holzkreuze sind an die Wand gelehnt, Blumen liegen dort und ein Dutzend Kerzen brennt. Ein paar junge Männer arbeiten noch an der Kapelle, ohne große Eile gießen sie den Betonboden.
»Deren Blut den Frieden nähren soll«
Die alte Kirche, in der im Dezember 1997 die ersten Opfer beschossen wurden, ist zum Schlafraum für ausländische Beobachter geworden. Etwas unheimlich wirken die Einschußlöcher in den Holzwänden schon, geben zwei junge Frauen zu, die gemeinsam mit einigen Tzotzil-Kindern Blumenbilder malen, doch sie nähmen sie kaum noch wahr.
Die neue Kirche hingegen hat keine Außenwände, über die Holzpfeiler ist nur eine Plastikplane gespannt. Auf dem Altar stehen einige Marien- und Jesusstatuen unterschiedlicher Größe, ein besticktes Tuch erinnert an die Toten, »deren Blut den Frieden nähren« soll. Hier in der Kirche finden die wenigen Kurse statt, und alle Versammlungen. So sitzen etwa 40 Frauen in blumenbestickten Trachten auf den Holzbänken und lernen anhand praktischer Beispiele rechnen: Wieviel Baumwolle von welcher Farbe braucht man für wieviel Stickereien, und was kostet die entsprechende Menge?
Keine der Frauen kann tatsächlich Baumwolle kaufen, denn sie haben nicht einmal genug zum Überleben und sind auf Nahrungsspenden des Bistums von San Cristobal und des Roten Kreuzes angewiesen. Auf die Felder geht auch niemand, da die Gegend nach wie vor von Paramilitärs unsicher gemacht wird. Kaum einer der Bewohner und schon gar keiner von den Flüchtlingen, die nach Monaten der Abwesenheit in ihre provisorischen Hütten nach Acteal zurückgekehrt sind, hat hier wirklich etwas zu tun. »Wir sind traurig«, sagt eine junge Tzotzil-Indianerin mit gesenktem Kopf leise, »es gibt nichts mehr.« Zurückgekehrt sind sie dennoch, sie wollten bei den Toten sein.
Einige Überlebende des Massakers tragen große Narben, anderen sind Arme und Beine verstümmelt. Dem vierjährigen Juan wurde die Hand durch Machetenhiebe so schwer verletzt, daß sie amputiert werden mußte. Eine geschwungene Narbe reicht quer über seinen Brustkorb.
In einem neueren Gebäude sitzt ein Mann einsam auf dem Webstuhl. Dutzende verbringen ihre Tage schweigend, vor ihren Hütten sitzend. Mehr als 200 Kinder teilen die Apathie der Erwachsenen. Außerhalb des Dorfes können sie nicht spielen, eine Schule gibt es in Acteal nicht, geschweige denn Lehrer. Dafür fährt alle zehn Minuten ein Militärlastwagen die Hauptstraße entlang. Durch die Bäume hindurch sieht man ihn vom Dorfplatz aus. »Wenn man hier ist, spürt man den Druck der Armee: Sie observieren, fotografieren... Und wenn man die Gemeinde verläßt oder zurückkommt, herrscht ebenfalls Spannung«, erzählt Ernesto Rodriguez, der seit nahezu einem Jahr als Arzt in Acteal arbeitet. »Die Armee hat Straßensperren errichtet, sie halten dich an, durchsuchen dich, fragen dich, wohin du gehst, warum und wozu, sie verlangen deinen Ausweis, obwohl sie kein Recht dazu haben, aber sonst wirst du verhaftet. Dann sagen sie zu dir: Du bist nicht von hier, was machst du hier? Sie fragen dich aus und du gehst immer Gefahr, verhaftet zu werden. Mir ist das in Chenalhó passiert.«
Ernesto Rodriguez hatte eine gute Anstellung an der medizinischen Fakultät in der Hauptstadt, bis er den Drang verspürte, nach Chiapas zu gehen. Er sprach mit seiner Frau, packte seine Sachen und heuerte zu einem Mimimallohn bei der Hilfsorganisation »Ärzte der Welt« an. In dem kleinen Holzverschlag, der ihm als Praxis dient, hat Ernesto immer Gesellschaft: Er bildet Tzotzil-Indianer aus den umliegenden Gemeinden in den Grundlagen der Medizin aus, damit sie zumindest bei einfachen Krankheiten oder in Notfällen Soforthilfe leisten können. »Die Gemeinschaft hat uns sehr gut und freundlich aufgenommen, wir sind ja gekommen, um sie zu unterstützen. Aber die Militärs... Physisch haben sie mich zwar noch nicht angegriffen, aber immer wieder werde ich von ihnen beschimpft und beleidigt, wenn ich auf der Straße laufe. Die ständige Bedrohung führt zu dauerhafter Anspannung, die dich einfach nicht ruhig arbeiten läßt.«
»Ich kann gehen, die Flüchtlinge nicht«
Ruhe hätte Ernesto bitter nötig. Alleine für mehr als 2000 Menschen in Acteal und einige Tausend mehr aus anderen Dörfern zuständig zu sein, ist kein leichter Job. »Die Flüchtlinge verfügen nicht über die Mittel, ihre Gesundheit zu pflegen. Es gibt Probleme wegen der fehlenden Latrinen, wegen der Ernährung, wegen des Wassers, der Müllentsorgung, und die spiegelt sich eben in der gesundheitlichen Situation wieder. Erkrankungen des Verdauungstraktes sind alltäglich, gerade sind auch Salmonellen und Typhus weit verbreitet.« Ernesto weiß nicht, wie lange er das noch aushält. Doch gibt er zu, Glück zu haben: »Ich kann wieder gehen, die Flüchtlinge nicht. Wohin sollen sie auch?«